
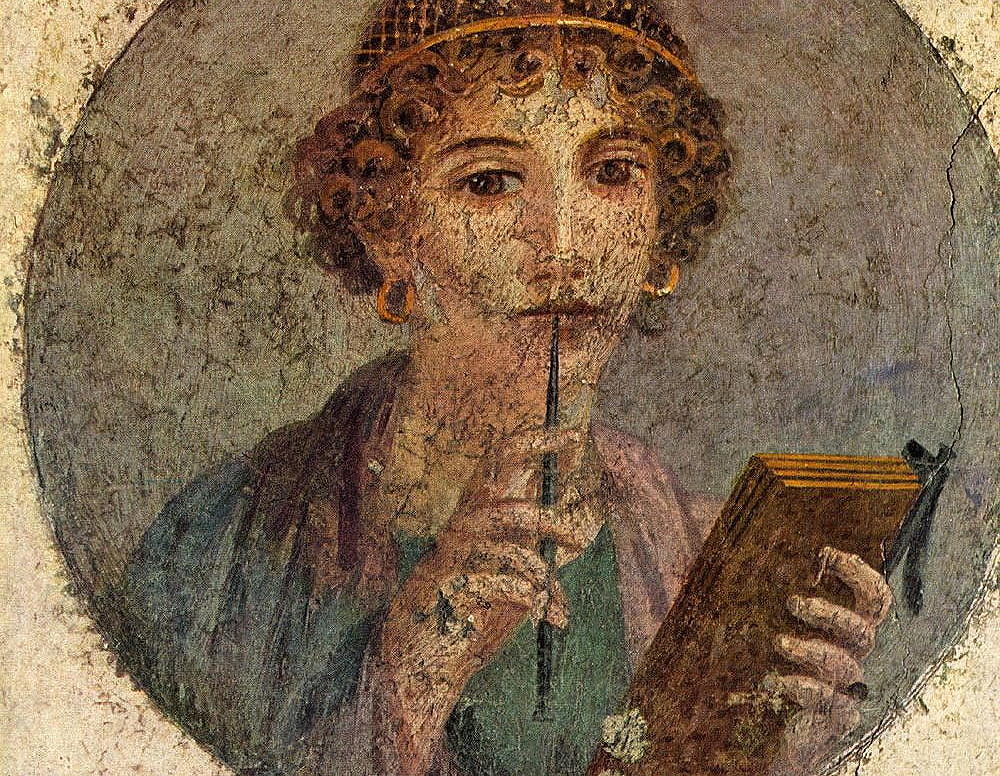

Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus
| Autor*in: | Carolin Amlinger & Oliver Nachtwey |
|---|---|
| Verlag: | Suhrkamp-Verlag, Berlin 2025, 453 Seiten |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 18.11.2025 |
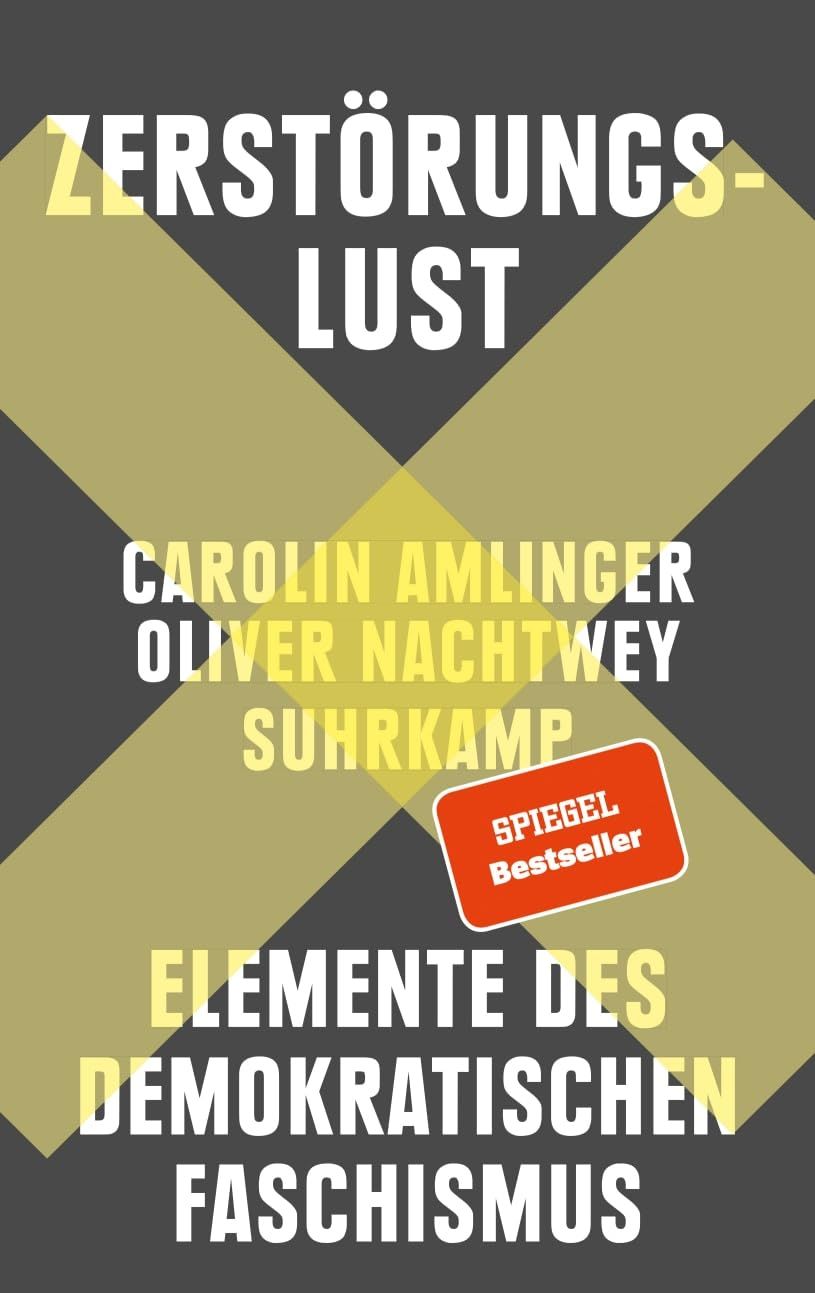
Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus ist die Fortsetzung und Zuspitzung der Diagnose, die Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey bereits in Gekränkte Freiheit (2023) entwickelt haben. Wieder geht es um die inneren Widersprüche liberaler Demokratien – diesmal jedoch mit der expliziten Frage, wie aus Enttäuschung und Kränkung eine bedenkliche Lust an der Zerstörung demokratischer Institutionen entsteht. Zerstörungslust erschien 2025, wurde rasch breit diskutiert und mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet.
Wer sind die Autoren? Carolin Amlinger, Jahrgang 1984, ist Literaturwissenschaftlerin und Soziologin, lehrt an der Universität Basel und wurde mit einer vielbeachteten literatursoziologischen Dissertation (Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit, 2021) bekannt. Ihre Schwerpunkte liegen in Literatursoziologie, kritischer Gesellschaftstheorie und Autoritarismusforschung. Oliver Nachtwey, Jahrgang 1975, ist Professor für Sozialstrukturanalyse, ebenfalls in Basel, 2016 ausgezeichnet für Die Abstiegsgesellschaft und als Analytiker sozialer Abstiegsängste und spätkapitalistischer Krisendynamiken etabliert.
Die zentrale These des Buches lautet, dass Faschismus aktuell nicht primär als bevorstehende Diktatur zu fassen ist, sondern als bereits gegenwärtige „faschistische Fantasie“ inmitten der liberalen Demokratie. Amlinger und Nachtwey sprechen deshalb von „demokratischem Faschismus“, einer Haltung, die sich formal auf Demokratie, Volkssouveränität und Freiheitsrechte beruft, diese Begriffe jedoch als Vehikel in einer destruktiven, antidemokratischen Agenda missbraucht. Im Unterschied zum historischen Faschismus, der die parlamentarische Demokratie offen zerstören wollte, baut der demokratische Faschismus auf demokratische Verfahren wie Wahlen, Parteien und Redefreiheit, um letztlich jene Institutionen zu untergraben und auszuhebeln, auf die er sich rhetorisch beruft.
Erklärt wird diese neue Konstellation aus einer umfassenden Krisendiagnose moderner Gesellschaften. Ausgangspunkt ist eine von den Autoren beschriebene „Polykrise“: Klimawandel, Kriege, Pandemie-Folgen, Inflation, globale Migration und digitale Verunsicherung. Das zentrale Versprechen liberaler Demokratien – stetiger Fortschritt durch Wachstum – scheint nicht mehr einlösbar zu sein. Die vorhandenen Ressourcen reichen nicht mehr für eine spürbare Umverteilung von oben nach unten. Der historische Konfliktlösungsmechanismus der sozialen Marktdemokratien war das Zuschütten der Konflikte und Unzufriedenheit mit immer mehr sozialen Leistungen. Damit, so Amlinger und Nachtwey, erscheint die Zukunft nicht länger als offener Möglichkeitsraum, sondern als Bedrohung. Die Vergangenheit kehrt in Form autoritärer Fantasien zurück.
Diese Diagnose wird mit einer sozialpsychologischen Figur verknüpft, die erkennbar an Erich Fromms Furcht vor der Freiheit (1941) anknüpft. Wie Fromm beschreiben die Autoren spätmoderne Subjekte, die formal freier denn je, sich subjektiv aber „blockiert“ fühlen. Sie erleben Arbeit, Wohnen, Familie und Geschlechterordnung als unsicher und bedroht, ohne dieses Gefühl politisch organisieren zu können. Aus dieser Konstellation erwächst die Sehnsucht, eine Welt, die einem „den Atem nimmt“, lieber selbst zu zerstören, als von ihr „zerkaut“ zu werden. Statt kollektiver Fortschrittsutopien dominieren ressentimentgeladene Fantasien des Abrisses: des Systems, der Eliten, der „woken Minderheiten“.
Empirisch stützen Amlinger und Nachtwey ihre Thesen auf zwei Säulen. Zum einen haben sie eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage mit 2.600 Befragten durchgeführt, in der spezifische Haltungen destruktiver Mentalitäten erhoben werden – etwa Zustimmung zu Aussagen, die eine Freude am Zusammenbruch oder eine besondere Grausamkeitsbereitschaft markieren. Etwa 12,5 Prozent der Befragten ordnen sie als mittel oder hoch destruktiv ein; diese Gruppe ist überdurchschnittlich jung, eher männlich und politisch überwiegend rechts orientiert. Zum anderen führten sie 41 Tiefeninterviews mit Personen, die in eine „destruktive Drift“ geraten sind: AfD-Wählerinnen und -Wähler, libertäre Aktivisten, verschwörungsoffene Milieus, Trump- und Musk-Anhänger. Aus diesen Gesprächen entwickeln sie eine Dreier-Typologie von „Erneuerern“, die hoffen, durch Gewalt und institutionelle Sprengung eine alte, „weiße“ Hierarchie zurückzugewinnen, „Zerstörern“, die den Untergang des Systems als Selbstzweck erleben, und „libertären Autoritären“, die den regulierenden Sozialstaat beseitigen und durch autoritäre Ordnung ersetzen wollen.
Damit löst sich das Buch von links- und rechtsextremen Parteien und nimmt die subjektiven Motivlagen verschiedener Milieus in den Blick. Amlinger und Nachtwey rekonstruieren die Biografien als „blockierte Leben“, in denen Aufstiegsversprechen nicht eingelöst worden sind und gesellschaftliche Konflikte – Migranten, Feministinnen, urbane Eliten – an die Stelle klassischer Klassenkonflikte treten. Der „demokratische Faschist“ erscheint nicht als marginaler Neonazi, sondern als verunsicherter Mittelschichtsbürger, der sich von woken, ökologischen und feministischen Minderheiten beherrscht fühlt und diese Frustration in einer Lust an der Zerstörung der sie hervorbringenden liberalen Ordnung zum Ausdruck bringt.
Amlinger und Nachtwey greifen auf Theodor J. Geigers Krisendiagnose der 1930er Jahre zurück, auf die neuere Forschung zur autoritären Persönlichkeit (etwa Ferdinand Sutterlüty) und auf Erich Fromms Analyse der Flucht aus der Freiheit. Bei der engeren Faschismusbestimmung orientieren sie sich an Roger Griffin (The Nature of Fascism, London 1991), der Faschismus als „palingenetischen Ultranationalismus“ definiert; Palingenese bedeutet nichts anderes als Wiedergeburt. Weitere Referenzautoren sind Klaus Theweleits Gewalt-Analysen und Franz L. Neumanns materialistische Interpretation des Nationalsozialismus.
Ein neuartiger Zug des Buches ist der Anspruch, die autoritären Milieus nicht nur zu verurteilen, sondern zu verstehen. In Anlehnung an Roger Griffin sprechen die Autoren von „methodischer Empathie“: Man müsse die „ideelle Performance“ des Faschismus – die Selbstdeutungen, Witze, Fantasien, Übertreibungen – ernst nehmen, ohne sie zu entschuldigen. Verstehen sei ausdrücklich nicht verzeihen, sondern die Voraussetzung, faschistische Dynamiken präziser analysieren und politisch wirksam bekämpfen zu können.
Unter „demokratischem Faschismus“ verstehen Amlinger und Nachtwey daher weniger eine organisierte Bewegung oder einen geschlossenen Block, sondern ein Netzwerk, eine diffuse Allianz der Destruktion, die soziale Medien, Protestbewegungen, Parteien und medial wirksame Führungsfiguren verbindet. Diese Netzwerke operieren mit einem frivolen Spiel mit Wahrheit, alternativen Fakten, Verschwörungserzählungen und maßlosen Übertreibungen. Gemeinsamer Kern sei eine hohe Gewalt- und Grausamkeitsbereitschaft gegenüber Gruppen, die als bedrohlich wahrgenommen werden, verbunden mit dem Wunsch, die bestehenden Institutionen zu nutzen, um sie in letzter Konsequenz auszuschalten.
Die Autoren von Zerstörungslust konzentrieren sich auf die Destruktivität von Donald Trump, Elon Musk, der AfD und verwandten Bewegungen. Rechtsradikale Bewegungen sind derzeit stärker als die Linksradikalen, aber auch Linksextremisten arbeiten an einer Zerstörung der Demokratie und der Meinungsfreiheit (cancel culture). Diese Seite wird von Amlinger und Nachtwey wenig beachtet. Und auch die auf lange Sicht zerstörerische Macht des Kritik-Trommelfeuers sogar etablierter Medien gegen gewählte bürgerliche Parteien kommt nicht in den Blick. Die Lust am Niederbrennen der liberalen Ordnung ist nicht nur bei Rechten vorhanden.
Amlinger und Nachtwey sind keine Politiker, sondern Soziologen. Sie verzichten darauf, Ratschläge zu geben. Aber sie bestehen auf der Verpflichtung, sich im Alltag wie in der Politik ehrlich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen. Dazu zählen sie eine zunehmende gesellschaftliche Ungleichheit, mangelnde Teilhabe der Menschen an der sozialen Entwicklung, ein Nachlassen des Wirtschaftswachstums und die ökologischen Grenzen des Wirtschaftsliberalismus. An dieser Stelle wird das Buch ungenau. Ist die Ungleichheit möglicherweise nur ein extremistisches Narrativ, um die Gesellschaft zu destabilisieren? Wie kann eine mangelnde Teilhabe der Menschen beklagt werden, bei ausgeweiteten Teilhabemöglichkeiten? Ein stetiges Wirtschaftswachstum wird auch von Links- und Rechtsextremen nicht infrage gestellt. Und gerade die ökologischen Grenzen des Wirtschaftswachstums wird vom extrem rechten politischen Rand negiert oder infrage gestellt. Ökologische Fragen haben im „demokratischen Faschismus“ keinen Platz. Bleibt die Verunsicherung durch die Migration aus arabisch-islamischen Ländern, deren negative Auswirkungen Thilo Sarrazin schon 2010 beschrieben hat (Deutschland schafft sich ab).
Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung nennen Amlinger und Nachtwey die Migration explizit als einen der Mechanismen, über die sich Menschen verunsichert fühlten. Sie sprechen von empfundenen Kränkungen und befürchtetem Statusverlust, wobei Migration eine häufige Projektionsfläche für subjektive Ängste sei. Sie differenzieren nicht danach, welche Form der Migration – etwa aus arabisch-islamischen Ländern – wirkt, welche kulturellen Inhalte damit verbunden sind oder in welchem Maße ethnische oder religiöse Zuschreibungen konkret eine Rolle spielen. Auf diesen zentralen politischen Konflikt der Gegenwart gehen sie nicht ein, obwohl er mit am stärksten die Zerstörungslust rechtsextremistischer Milieus erklären könnte. Amlinger und Nachtwey verstehen Migration eher als Symbol oder Trigger eines verbreiteten Gefühls der gesellschaftlichen Blockierung und des Abschieds vom Fortschrittsversprechen.
Das Buch ist ein ernstzunehmender Versuch, die Lust an der Zerstörung der liberalen Ordnung nicht nur moralisch zu verurteilen, sondern in ihren sozialen und psychischen Voraussetzungen zu verstehen. Zerstörungslust ist eine dichte, empirisch fundierte und theoretisch ambitionierte Analyse destruktiver Affekte, vor allem in Deutschland, aber auch weltweit. Die Analyse der Poly-Krise ist freilich nicht neu und schon oftmals versucht worden. Mit dem „demokratischen Faschismus“ als Zeitdiagnose jedoch gehen die beiden Autoren erklärungsmäßig einen Schritt weiter. Die Juroren des Geschwister-Scholl-Preises halten des Buch wegen seiner geistigen Unabhängigkeit für preiswürdig. Es sei geeignet, bürgerliche Freiheit und moralischen Mut zu fördern und dem Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse zu geben, heißt es zur Begründung des 2025 vergebenen Preises.