
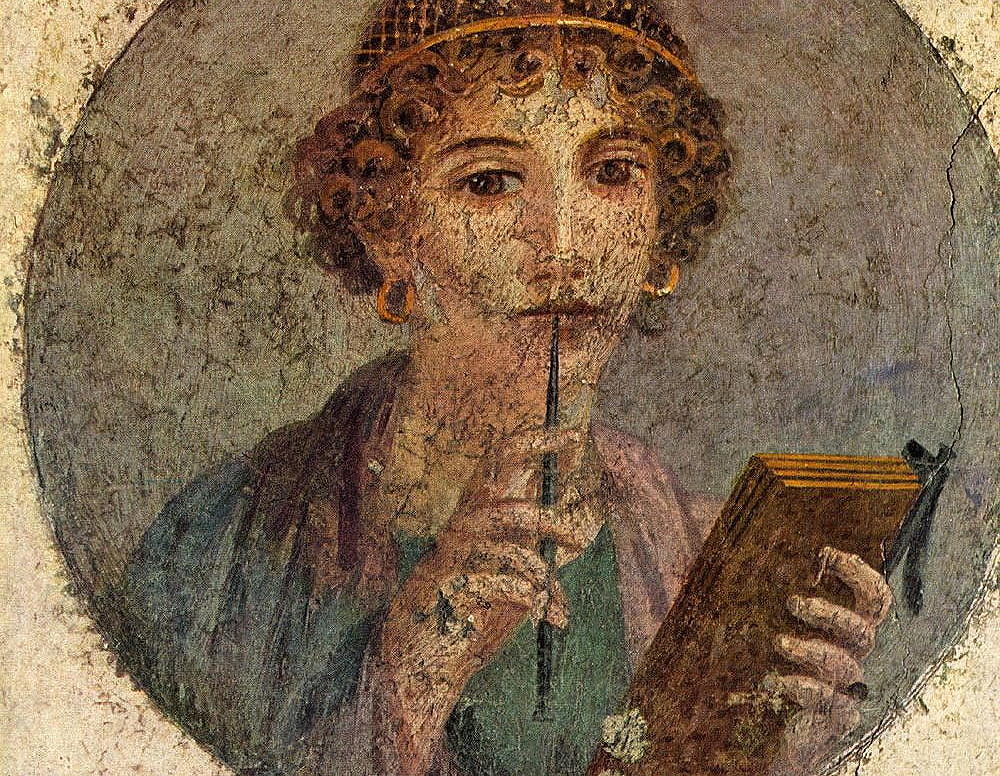

Wie wir sterben. Ein Ende in Würde?
| Autor*in: | Sherwin B. Nuland |
|---|---|
| Verlag: | Kindler, München 1993, 400 Seiten |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 06.10.2025 |
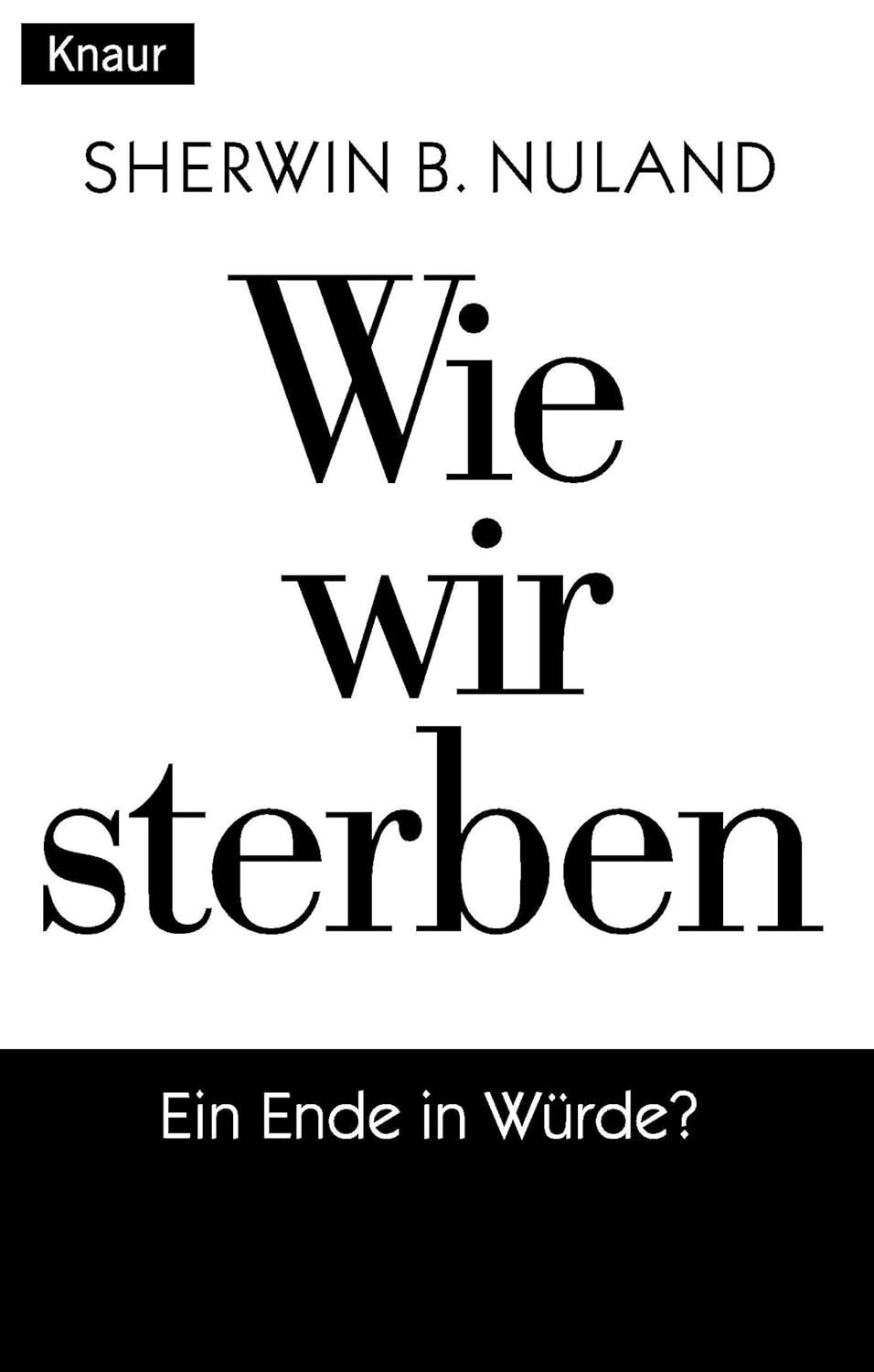
Der Amerikaner Sherwin Nuland, renommierter Chirurg und Medizinhistoriker an der Yale-Universität, nimmt in diesem Buch den Tod weder glorifizierend noch beschönigend in den Blick. Er möchte das Sterben „entmythologisieren“ – weg von romantischen Vorstellungen hin zu einer schonungslosen, aber ehrlichen Darstellung der biologischen und klinischen Realität. Nulands Anliegen ist es, Krankheiten, die zum Tode führen, den Lesern verständlich zu machen.
Ausgehend von der Krankheits- und Todesgeschichte seiner Großmutter vertieft er in ausführlichen Kapiteln typische Todesursachen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Alzheimer, Krebs, septischen Schock und AIDS. Hinzu kommen Unfälle und Selbstmord. In der Regel sterben Menschen jedoch an Altersschwäche. Die Alterungserscheinungen des Lebens mit dem Verschleiß der Knorpel, dem Zuwachsen der Arterien, dem „Selbstmord“ von Zellen, überhaupt der Zellalterung, sind unvermeidliche Prozesse.
Nuland hält wenig vom menschlichen Wunsch nach ewiger Jugend und endlosem Leben. Alte Menschen müssen sterben, sonst würde die Welt vergreisen. Nur die Jugend sieht und entdeckt mit neuen Augen Neues. Sie findet neue Antworten auf neue Herausforderungen. Alles Lebendige stirbt und macht den danach Kommenden Platz. Die Natur meint es gut mit uns, ohne es zu wissen, und sie kann andererseits auch grausam sein, ohne es zu wissen.
Schwerwiegende Erkrankungen haben keinen Sinn, betont der Autor. Es gibt keinen verborgenen Zusammenhang, keine verborgene Moral. Krankheit ist keine Metapher, keine Allegorie, kein Symbol und auch kein Vorbote der Apokalypse, sondern eine Bewährungsprobe der Menschlichkeit. Viele Krankheiten sind entwürdigend, daran lässt er keinen Zweifel. Ein „Ende in Würde“ sei wünschenswert, doch viele Krankheiten geben dem Betroffenen dazu keine Gelegenheit.
Alle Krankheiten sind Willkürakte der Natur. Was man allenfalls erwarten kann, ist ein schmerzfreies und friedliches Ende. Man kann kaum mehr tun, als den Sterbenden sauber und möglichst schmerzfrei zu halten und ihn nicht allein zu lassen. Zur Würde gehört Offenheit. Die Diagnose und der Stand der Erkrankung sollten dem Patienten nicht verschwiegen werden. Nur so kann er bewusst Abschied von seinen Lieben nehmen.
Würde scheint etwas zu sein, das nur die Überlebenden suchen. Sie suchen nach Würde, damit sie nicht schlecht von sich selbst denken müssen. Würde ist nicht zu erhalten, wenn ein Mensch allmählich seine Individualität und Einzigartigkeit verliert. Es sei bedrückend, wie aus einem Individuum ein klinischer Fall wird. Die Natur behält letztlich die Oberhand. Die Grenze, jenseits derer eine Therapie keinen Sinn mehr macht, war schon immer verschwommen und wird es auch bleiben. Nuland kritisiert die moderne Medizin dafür, Sterben als Misserfolg zu behandeln.
Das Buch ist kein Ratgeberbuch. Der Autor verwebt darin biografische Anekdoten mit medizinischem Fachwissen und literarischen Zitaten. Nuland zeigt, dass unsere Endlichkeit dem Leben Dringlichkeit und Bedeutung verleiht. Sherwin Nulands Wie wir sterben ist ein nüchterner wie auch empathischer Zugang zu einem Thema, das gesellschaftlich oft ausgespart wird – aber täglich stattfindet. Mit seinem klinischen Wissen zeigt der Autor die Unausweichlichkeit des Verfalls und fordert den Leser zugleich heraus, Verantwortung für seinen Lebensweg und das Lebensende zu übernehmen. Das Buch ebnet den Weg zu einer bewussteren und unsentimentalen Auseinandersetzung mit dem Sterben und könnte für alle bereichernd sein, die sich mit dem Thema Leben und Tod beschäftigen wollen.