
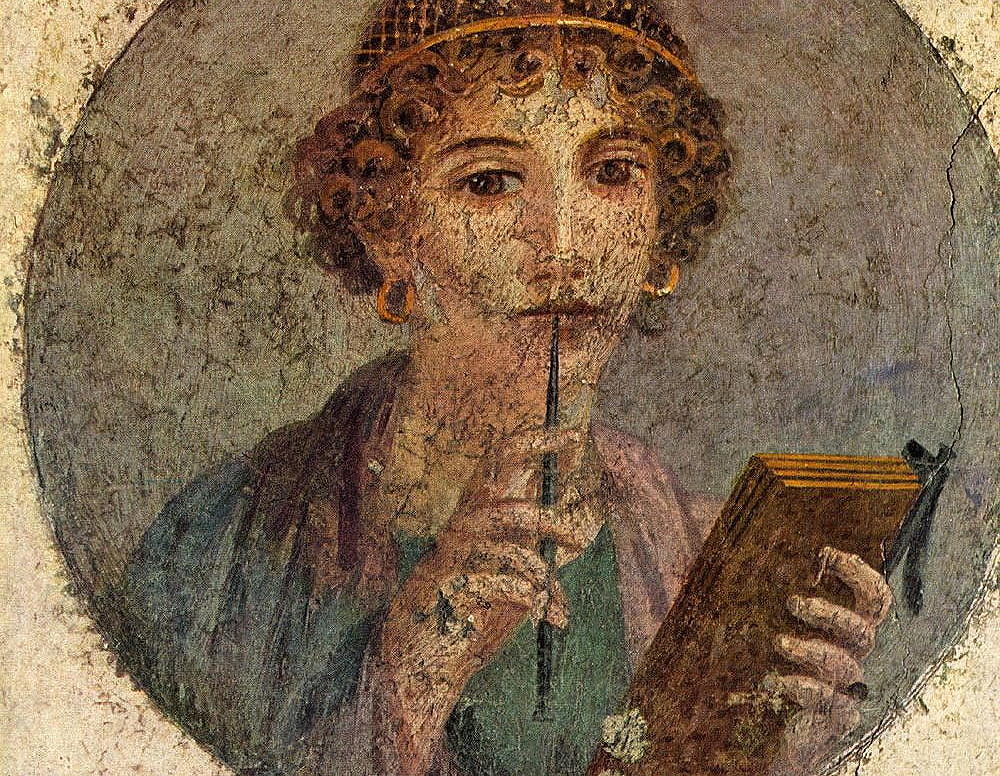

The Rise of the Creative Class
| Autor*in: | Richard Florida |
|---|---|
| Verlag: | Basic Books, New York; aktualisierte Ausgabe 2019, 512 Seiten. Erstausgabe 2002 |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 11.08.2025 |
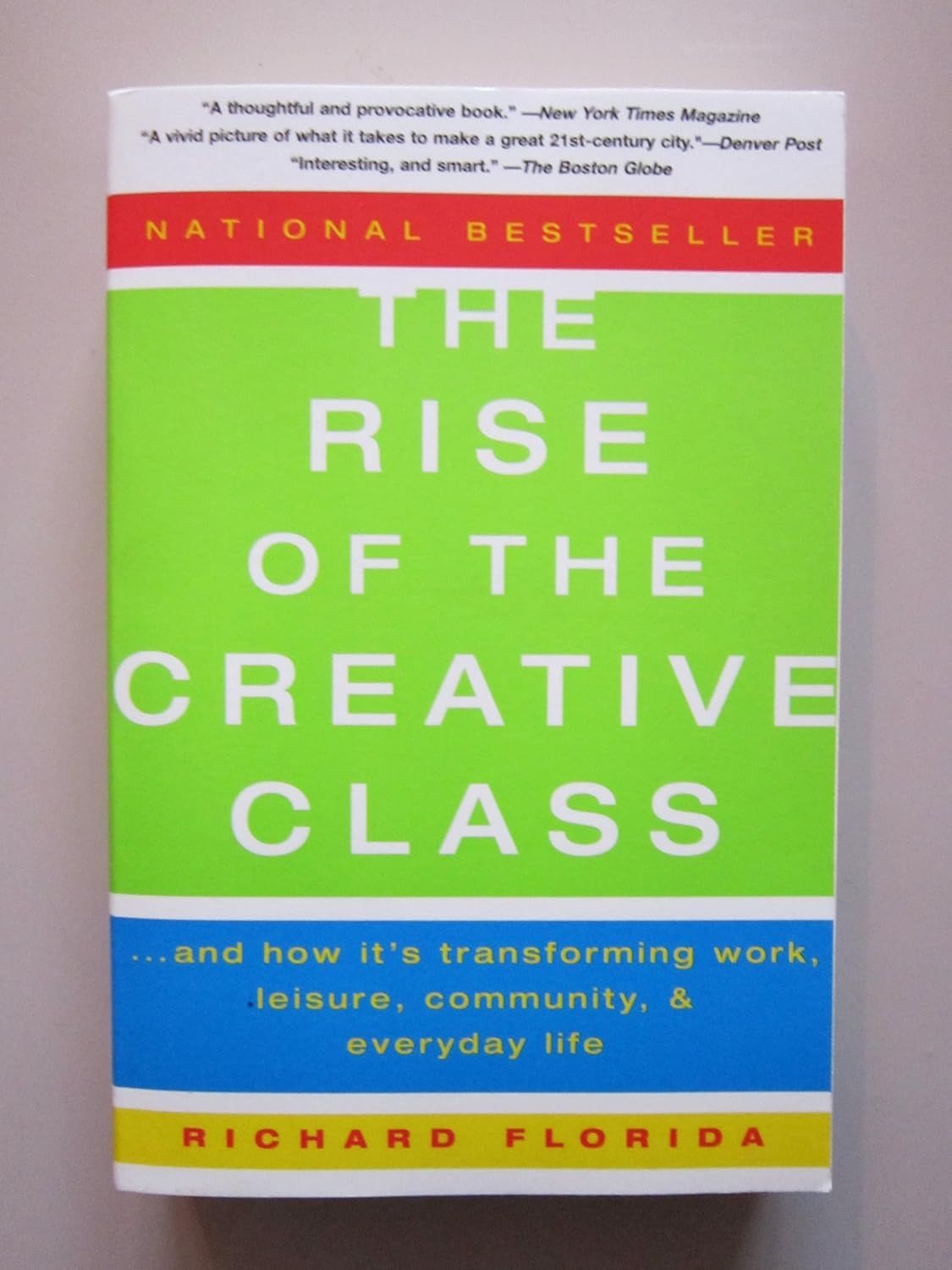
In seinem modernen Klassiker The Rise of the Creative Class (Erstausgabe 2002) beschreibt der US-Stadtplaner Richard Florida den Einfluss einer neuen sozialen Klasse, die die Städte des 21. Jahrhunderts maßgeblich neu mitgestaltet. Diese kreative Klasse besteht aus Ingenieuren und Managern, Akademikern und Musikern, Forschern, Designern, Unternehmern und Anwälten, Dichtern und Programmierern, die zusammen rund 30 Prozent der Erwerbstätigen ausmachen würden. Damit wäre „die Elite“ nicht mehr eine kleine, abgehobene Klasse, sondern eine breite Bewegung in liberalen Gesellschaften und westlichen Städten.
Florida bietet ein detailliertes berufliches, demografisches, psychologisches und wirtschaftliches Profil der kreativen Klasse, untersucht ihre globalen Auswirkungen und erforscht die Faktoren, die die Lebensqualität in sich wandelnden Städten und Vororten prägen. Es wurde breit diskutiert, oftmals zustimmend, teilweise kritisch rezipiert. 2019 erschien das englischsprachige Werk mit einem neuen Vorwort.
Floridas The Rise of the Creative Class zeichnet ein visionäres Bild: Die „kreative Klasse“ würde Wirtschaftswachstum und urbane Prosperität antreiben. Zentral ist seine These, dass Städte, die Technologie, Talent und Toleranz – seine „3 T“ – fördern, besonders attraktiv werden. Politiker und Stadtplaner übernahmen die Ideen des US-Ökonomen für Stadtentwicklungsstrategien – mit Café‑Kultur, Kunstvierteln und urbanem Mix als Imageträger des „Coolen“. Natürlich wird die städtische Wirtschaft heute eher von Angestellten als von Industriearbeitern geprägt. Sie schaffen eine Atmosphäre kultureller Vielfalt und Innovation, die offensichtlich produktivere Menschen anzieht, die viele Wahlmöglichkeiten hinsichtlich ihres Wohnortes haben und sich für Orte entscheiden, die sie spannend und attraktiv finden. Floridas nennt Seattle, Austin und natürlich New York.
Wie hoch die tatsächlichen Innovationsimpulse sind, lässt sich nicht genau beziffern, und einige Kritiker Floridas bezweifeln generell den behaupteten Einfluss der urbanen Klasse. Andere Rezensenten steigern sich in ein misanthropes Wehklagen über Gentrifizierung und die Vertreibung der kleinen Leute aus ihren angestammten Wohnvierteln. Florida selbst ist auf diese Entwicklung in einem weiteren Buch eingegangen (The New Urban Crisis, 2018). Mobilität und Innovation bedrängen den Bestand; Bestandsschutz hemmt Mobilität und Innovation. Irgendwo dazwischen liegen die tatsächlichen Veränderungen.
Zweifel an Floridas optimistischer Sicht auf die neue urbane Elite weckt ein anderer Trend: der zum Eigenheim auf dem Land. Die Wanderungsbewegungen wechseln sich ab. Mal wird ein Trend zum Landleben ausgemacht, mal der zum Stadtleben. Beide Lebensformen haben ihre Vor- und Nachteile. Global geht der Trend eindeutig vom Land Richtung Stadt. Überall auf der Welt entvölkern sich Bauernhöfe und Dörfer und die Städte füllen sich. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist in diesem Jahrhundert auf dem Weg vom Dorf in die Stadt. Dort findet sich die kreative Klasse ein, nicht auf dem Dorf. Im Dorf lebt der Kreative, um sich von der Stadt zu erholen und ihren Belastungen zu entgehen. Städte und Dörfer erscheinen weniger als grundlegende Gegensätze, sondern eher als Punkte auf einem Kontinuum, mit dem „Vorort“ als Zwischenstation.
Bei allem Unbehagen an der Entwicklung bleibt die erstaunliche Feststellung, wie viele Menschen heute zur innovativen und gutverdienenden Elite zu zählen sind. Das wiederum ist ein deutlicher Hinweis auf die vorhandenen Aufstiegschancen in und die Durchlässigkeit von liberaler Gesellschaften.