
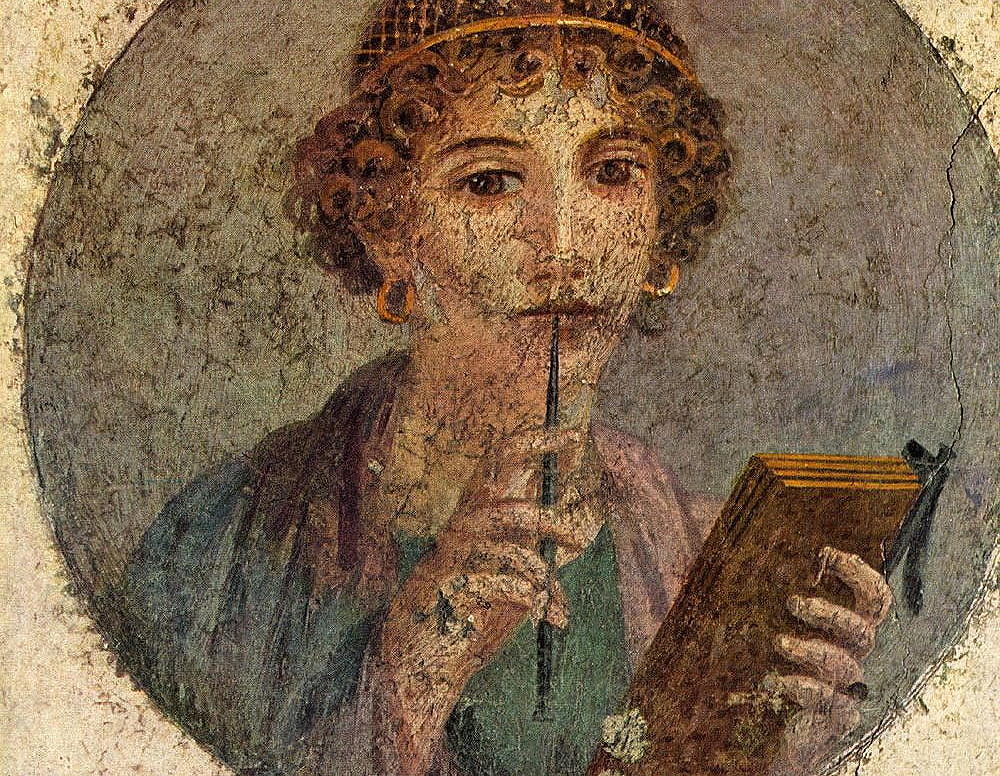

Systemkrise - Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus
| Autor*in: | Philipp Staab |
|---|---|
| Verlag: | Suhrkamp, Berlin 2025, 221 Seiten |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 29.10.2025 |
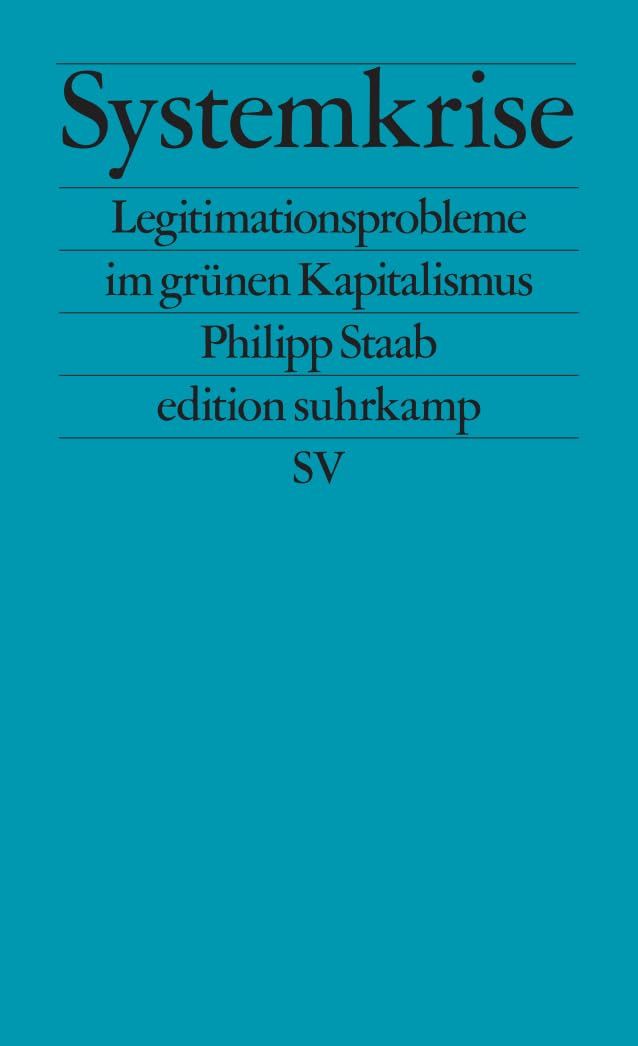
Jene Bundesregierungen, an denen die Sozialdemokraten und die Grünen beteiligt waren und sind, versprachen immer wieder ein grünes Wirtschaftswachstum und eine grüne Transformation der Gesellschaft. Die Umwelt sollte geschont und der Ressourcenverbrauch gesenkt werden. Durch neue umweltfreundliche Techniken würden neue Arbeitsplätze entstehen. Das alles sollte sozialverträglich und ohne nennenswerte zusätzliche Kosten für die Bürger ins Werk gesetzt werden. Obwohl angesichts der steigenden CO2-Konzentration angeblich die Auslöschung der Menschheit oder der Kollaps des Planeten in relativ naher Zukunft bevorsteht, soll die Transformation ohne spürbare Komforteinbuße über die Bühne gehen, niemand müsse auf irgendetwas verzichten.
Viele ahnten, dass dies nicht funktionieren würde. Philipp Staabs Buch Systemkrise - Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus bietet ein gelungene Erklärung für den zunehmenden Widerstand gegen eine ökologische Transformation der deutschen Wirtschaft. Während noch vor kurzem Hunderttausende auf der Straße für CO2-Einsparungen demonstrierten, schwindet zusehends die Bereitschaft, ambitionierte Klimaziele umzusetzen. Die Autobahnblockaden der Last Generation und die schrillen Anklagen von Fridays for Future stießen zunehmend auf teils wütende Ablehnung. Letzter Höhepunkt war die Zurückweisung des sogenannten Heizungsgesetzes. Wer sich generell Sorgen um den Klimawandel macht, hätte das Heizungsgesetz unterstützen müssen. Genau das geschah nicht.
Staab, Professor für Soziologie von Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel an der Humboldt-Universität zu Berlin und Direktor am Einstein Center Digital Future, sieht den „grünen Kapitalismus“ an sein Ende gekommen. Warum der Widerstand? Hat der grüne Modernisierungsstaat nicht Wohlstand für alle, Anhebung des Lebensstandards für die unteren Schichten und einen das Gewissen beruhigenden ökologischen Wandel ohne zusätzliche finanzielle Belastung der Bürger versprochen? Es muss tatsächlich eher überraschen, dass derart unhaltbare Versprechungen gemacht und geglaubt wurden.
Zugleich untergruben die grünen Transformierer ihre eigenen Versprechungen durch eine permanente Kritik an angeblich steigender Ungleichheit, zunehmender Ungerechtigkeit, „Spaltung der Gesellschaft“ und der Unfähigkeit aller anderen Parteien, den ökologischen Wandel in dem drängend geforderten Tempo umzusetzen. Sie denunzierten die kapitalistische Produktionsweise, die erst jene Geldmittel schafft, mit denen der Umbau finanziert werden kann. Die große Transformation versprach den Ausgleich sozialer Härten.
Da stattdessen die „Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinanderklafft“, lief in dieser Transformation offensichtlich etwas grundlegend schief. Die Strom- und Heizungskosten verringerten sich nicht. Der erzieherische Aspekt hoher Preise, nämlich den Verbrauch zu drosseln, schlug um in blanke Wut gegen die Teuerung. Die Einsparpotenziale beim Auto, bei der Heizung und dem Warmwasser scheinen bereits ausgeschöpft. Die Einführung und Verbreitung von Elektroautos wurden nicht dem Markt und der Nachfrage überlassen. Ohne staatliche Subvention bleibt die Nachfrage schleppend.
Einleuchtend ist Staabs „Kulturthese“ zur Erklärung des ökologischen Scheiterns: „Menschen lehnen den Modernisierungsprozess ab, weil sie sich einer nachhaltigen Lebensweise nicht wirklich verbunden fühlen.“ (Staab, 2025, S. 18ff) Ökologische Werte stehen im Widerspruch zu Werten der Individualität und der Freiheit. Alle diese Werte haben sich gleichzeitig in den westlichen Wohlstandsgesellschaften des 20. Jahrhunderts herausgebildet. Die Werte der Transformationsgesellschaft entwickeln sich auf der Grundlage der Einsicht, dass der Planet und seine Ressourcen endlich sind. Die liberale individuelle Autonomie und Selbstbestimmung hingegen versprechen Bequemlichkeit und Wohlbefinden.
Der Kern der grünen Transformation besteht eben nicht in Aussicht auf Verbesserung, sondern in einer diffusen Bedrohung des aktuellen Lebensstandards, was Abwehr hervorruft. Die Freiheit und Chancen kommender Generationen werden offenbar nicht durch eine unsichere und teurer werdende Energieversorgung gewährleistet. Individuelle Selbstentfaltung und globale Selbsterhaltung passen nicht zusammen. Die bekannte gesellschaftliche Ordnung wird ohnehin primär nicht radikal infrage gestellt durch eine Klimaerwärmung, sondern durch ein Bündel anderer Entwicklungen: Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, Rechtsradikalismus, Autoritarismus, moralisierende Übergriffe, Auflösung des öffentlichen Diskurses, Migration und vieles mehr.
Wird der Klimawandel, wird die Klimaerwärmung wirklich als eine Frage des Überlebens gesehen? Ein Großteil der Bevölkerung zieht in dieser Einschätzung nicht mit. Möglicherweise wird geahnt, dass jegliche CO2-Einsparung in Deutschland global nicht den geringsten Effekt hat. Elektroautos sparen über ihren gesamten Lebenszyklus keinerlei CO2 ein, im Vergleich zu Pkw mit Verbrennermotoren. Die Klimaerwärmung ist in Deutschland kaum spürbar. Selbst die transformationsbereiten Parteien setzten und setzen weiterhin auf Wirtschaftswachstum. Die Rede von der „Klimagerechtigkeit“ verliert Legitimität durch die Tatsache, dass weder der größte Emittent, China, noch die vielen reichen Öl-Schwellenländer bereit sind, die globalen Reduktionsziele mitzutragen und zu bezahlen.
Philipp Staab sieht nahezu keine Möglichkeit mehr, eine grüne Wirtschafts- und Gesellschaftstransformation umzusetzen. Er hofft auf Zufälle der kommenden Entwicklung und „unerwartete Gelegenheitsfenster“. Das Gebäudeenergiegesetz des früheren Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck war so eine Gelegenheit; sie wurde vertan. Selbst derartige relativ harmlose Eingriffe werden von vielen nicht mitgetragen. Ihnen erscheinen die gesellschaftlichen Verwerfungen, die mit dem Projekt der ökologischen Transformation in der liberalen Demokratie verbunden sind, nicht tragbar. In Staabs Diagnose wurde der „grüne Fortschritt“ selbst zur Quelle von Instabilität. Die Ablehnung staatlicher Übergriffigkeit wächst an zur offenen Ablehnung – nicht nur gegen Klimapolitik, sondern grundsätzlicher gegen liberale und demokratische Institutionen.
Das Buch überzeugt durch analytische Klarheit und den Mut, unbequeme Fragen zu stellen: Lässt sich eine gerechte grüne Transformation auf demokratischem Wege noch erreichen? Die Antwort lautet: Nein. Seine Thesen erhellen die Dynamik der gegenwärtigen gesellschaftlichen Fliehkräfte, bieten aber keine Aussicht auf eine allgemein akzeptierte Weiterentwicklung der grünen Transformation und damit auch keine Lösung für das Problem der Klimaerwärmung.