
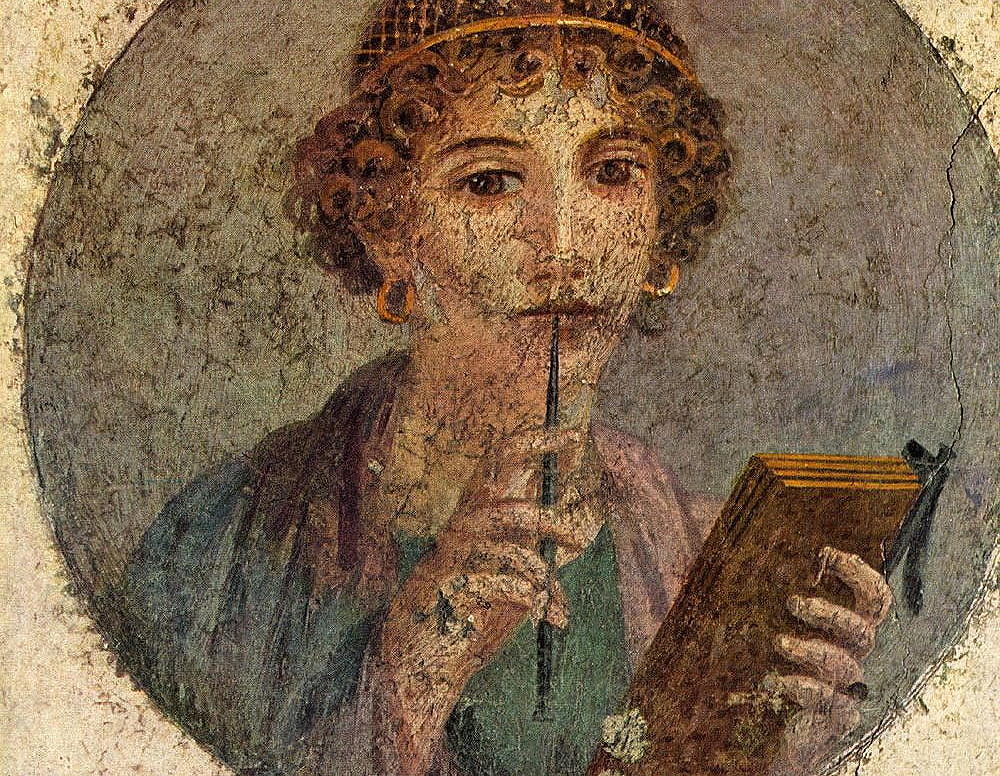

Explosive Moderne
| Autor*in: | Eva Illouz |
|---|---|
| Verlag: | Suhrkamp, Berlin 2024, 441 Seiten |
| Rezensent*in: | Matthias Voigt |
| Datum: | 11.08.2025 |
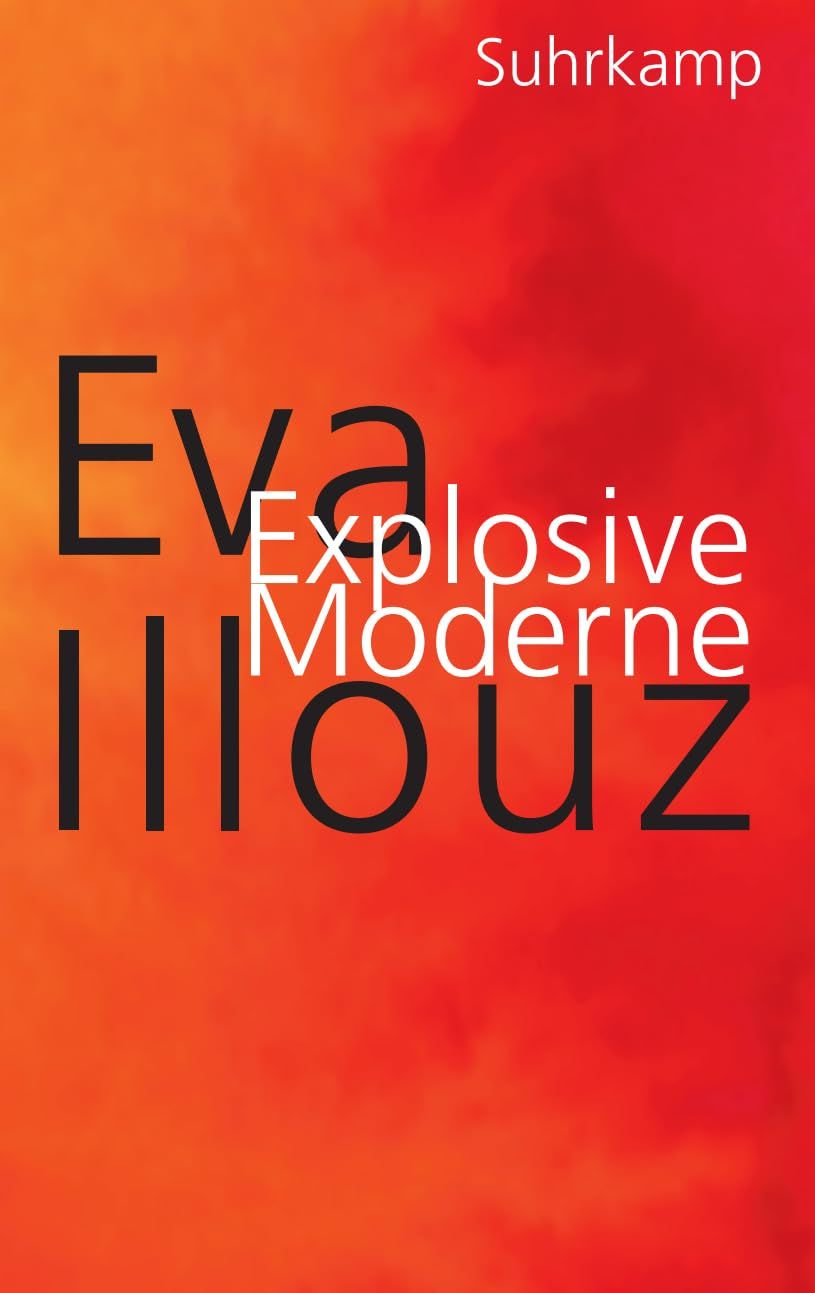
Dass sich Soziologen explizit des Gefühlsthemas annehmen, war für mich überraschend. Das neue Buch von Eva Illouz widmet sich dazu in neun Kapiteln jeweils einem Gefühlskomplex; sie beginnt mit der Hoffnung, um sich nach Neid, Eifersucht, Zorn und Scham zuletzt des Liebesthemas anzunehmen. Als Tochter sephardischer Juden in Marokko geboren, wissenschaftlich sozialisiert in Frankreich, ist Illouz heute im 64. Lebensjahr überall dort zuhause, wo die Wissenschaft der Soziologie lebendig ist. Neben dem existenziellen Denken französischer Prägung wurde sie von der schönen Literatur beeinflusst, deren Protagonisten sie bei der Veranschaulichung von Struktur- und Sinnbezügen mitreden lässt. Eine weltanschauliche Nähe zur klassischen Linken wird zuweilen vernehmbar, doch geht sie grundsätzlich ihren Gegenstand pragmatisch an.
In kulturanalytischer Perspektive will Illouz die Rolle der Gefühle in Bezug auf die sich in der Moderne vielschichtig durchdringenden Wirkkräfte beschreiben, um den facettenreichen Strukturzusammenhang der Kultur transparent zu machen. Hierbei geht es um die Aufhellung der Art und Weise, wie Menschen in ihren Interaktionen Bedeutungen produzieren und wie diese Bedeutungen in das soziale Netz eingeflochten werden. Diese im Kulturprozess sich wandelnden, von Gefühlen getragenen Bedeutungen geben den Umgang mit den anderen sein Gepräge.
Illouz’ Exploration der Rolle des Gefühls in der Moderne setzt ein in den Vereinigten Staaten, einem Land, in dem Einwanderer sich zu einem Staat formten. Zur Grundbefindlichkeit von Menschen, die ihre Heimat verlassen, gehört Hoffnung - ein Gefühl, das über größte Widerstände hinweghelfen kann. Doch im Hoffen gründet eine latente Gefahr der Enttäuschung. Zur Veranschaulichung der Dynamik einer von Enttäuschungs-Anfälligkeit geprägten Seele wählte Illouz Madame Bovary. Gustave Flaubert erzählt die Geschichte einer attraktiven jungen Frau, die einen harmlos-freundlichen Landarzt ehelicht. Die gute Partie verwandelt sich im Bewusstsein der Schönen in eine Quelle des Unglücks. Die Wirkung ihres Aussehens weckt in den anderen Bewunderung, die in ihr die Überzeugung hervorruft, zu Höherem berechtigt zu sein. In einer Welt, die keinem mehr per Geburt die Stellung in der Welt zuweist, können Wünsche nach Aufstieg in der gesellschaftlichen Hierarchie dominant werden.
In einem Gemeinwesen, das wie die USA ein Streben nach Glück in den Rang der Verfassung erhoben hat, sprudelt aus dieser Verheißung die Quelle des Neides. Wo jeder dieselbe Anwartschaft auf Teilhabe geltend machen kann, aber für einen Großteil immer weniger abfällt, vergiftet ein alles durchsetzendes Ressentiment gegen die vermeintlich Glücklicheren die soziale Realität. Die kapitalistische Ökonomie lebt vom Glauben, ein jeder könne entsprechend seinem Verdienst an den Früchten partizipieren.
Wo aber eine solche Meritokratie nach undurchschaubaren Kriterien die einen aufsteigen lässt, die Masse aber immer wieder enttäuscht, entstehen explosive seelische Bereitschaften. Zugleich nährt ein allzeit präsentes Angebot verheißungsvoller Konsumgüter das Gefühl von Sehnsucht und - ihr auf dem Fuße folgend - deren Enttäuschung durch die ausbleibende Wirkung. In der Dynamik, die diesem Gefühlskomplex innewohnt, erkennt Eva Illouz den Motor einer konsumistischen Lebensdynamik. Diese lenke alle Aktivität einer Kultur in vorgeprägte Bahnen. Darin wirkt die reaktive Kraft eines Ressentiments, das aus enttäuschter Hoffnung gespeist, von politischen Rattenfängern leicht in gefährliche Bahnen zu lenken sei.
Eine weitere Gefühlsdynamik im Prozess der Moderne macht Illouz an den neuen Erscheinungsformen der Angst fest. Deren Überwindung hatte sich der Liberalismus im Gefolge der Aufklärung auf die Fahnen geschrieben. Mit dem Fortschritt in den Wissenschaften und der durch sie angebahnten Beherrschung der Naturkräfte würde fortan alle Angst und Furcht einer realistischen Einsicht in die wirklichen Zusammenhänge weichen.
Doch mit dem rasanten Voranschreiten der kapitalistischen Produktion und damit der Ausweitung unseres Handlungsraumes erwuchsen ungeahnte Bedrohtheitsgefühle; denn Furcht als zersetzende Kraft ist dort allgegenwärtig, wo uns die Handlungskompetenz fehlt. Die Lebenswelt verwandelt sich zunehmend in einen Ort des Sich-Fürchtens. Das Unheimliche grundiert alles Gefühl und zeigt sich in Heimweh oder dem Empfinden von Heimatlosigkeit.
Franz Kafkas Parabel Die Verwandlung ist hier das sprechende Beispiel für den emotionalen Unterstrom der Moderne, der uns von einander entfremdet. Ihr Protagonist, ein kleiner Verwaltungsjurist, der noch im Elternhaus lebt, erwacht eines Morgens in Gestalt eines Käfers. Das unerklärliche Geschehen wird von allen Beteiligten nach Kräften verleugnet und treibt so auf immer unerträglichere Lebensverhältnisse hin.
Im Blick auf die politische Geschichte der Moderne verfolgt Eva Illouz die Dynamik von Furcht und Zorn. Zorn und daraus hervorgehend Empörung werden von ihr verstanden als unwillkürliche Reaktionen, mit denen sich eine Person aktiv der Verletzung eines zu ihr gehörigen Rechtes erwehrt. Kleists Michael Kohlhaas gibt das literarische Vorbild für Empörung ab. Zwei Seiten dieser Gefühlsreaktion scheinen auf, wenn Kohlhaas’ vergeblicher Einsatz für einen legitimen Rechtsanspruch schließlich in ein gewaltsames Durchsetzen-Wollen umschlägt. Das macht den Zornigen blind. Und wenn ganze Gruppen ihren Anspruch auf Gerechtigkeit geltend machen, kann das in Revolten die vereinten Kräfte explosiv zur Entladung bringen. Insofern ist eine latente Furchtsamkeit die Basis einer Zornes-Bereitschaft, die völlig unkontrollierbar werden kann.
Mit der Idee des Nationalstaates kam dann eine neuartige Begründung des Rechtsgefühl in die Welt, das sich um die Heimat-Thematik rankte. Das Phantom einer angeblich verlorenen Heimat wird zum virtuellen Vereinigungspunkt. Man postuliert als Volk eine vermeintlich ethnisch einheitliche Gruppe (z.B. die arische Rasse), die einst in Einigkeit zusammengelebt habe. Aus dem imaginären Verlust begründet man einen Anspruch auf Wiedergewinnung des ursprünglichen Besitzes. Bis heute scheint eine solche nostalgische Gefühlspolitik neue Früchte zu tragen. Die Erfolge der AfD in Deutschland und die Wiederwahl Trumps in den USA dürften damit treffend erklärt sein.
In diesen Komplex von Wunschvorstellungen, für deren Realität dann die Intensität der kollektiven Empörung als Beweis herhalten muss, gehört eine zunehmende Bereitschaft, sich von allem und jedem in seinen vermeintlichen Rechten verletzt zu sehen. Eine eigentliche Handlung zur Herbeiführung des Besseren erfolgt nicht. Wer nämlich sein wirkliches Recht durchsetzen wollte, von dem ist tapferer Einsatz gefordert für die entsprechende Sache. Demonstrative Verletztheit kann zur Waffe für den werden, der sich als ungerecht behandelt imaginiert. In einem Kult der Betroffenheit wird der Mangel an Tapferkeit ersetzt durch eine ins Passiv-Aggressive gewendete Furcht. Gefördert wird diese Haltung in demokratischen Gesellschaften von einer Politik, die Gerechtigkeit durch Ausgleichsmaßnahmen sozialer Unterschiede bewirken will.
Damit nähert sich die Rolle der Politik immer weiter dem Therapeutischen an. Man demonstriert seine Empathie mit Bürgerinnen und Bürgern, die in der Nachfolge Sigmund Freuds neue Methoden der Selbstdeutung erworben haben. Im neuen Idiom der Gefühle und Befindlichkeiten verwandelt sich mit diesem Instrument der Wunsch nach Anerkennung in einen vermeintlich legitimen Anspruch.
Was Illouz in den Kapiteln zum Thema von Scham und Stolz uns Psychotherapeuten zu sagen hat, sind Sachverhalte, die in der Psychotherapie bisweilen vernachlässigt werden. Die innerseelischen Dynamismen, von denen die tiefenpsychologischen Schulen sprechen, haben ihre Außenseite im sozio-ökonomischen und institutionellen Beziehungsgeflecht, in dem sich ein Menschenleben abspielt. In der Moderne, so Illouz’ Diagnose, treibt gerade dieser verstärkte Blick auf das eigene Ich den Mechanismus einer Selbstzerstörung des Individuums. Es verliert sich in weltloser Innerlichkeit. Was sich die psychotherapeutische Kultur auf die Fahnen geschrieben hat, die Förderung des Individuums, trüge demnach zu seinem Untergang bei.
Das letzte Kapitel des lehrreichen Buches gilt der Liebe. Hierin äußert die Autorin, was ihr selbst an diesem vieldeutigen Phänomen als Hoffnung zu gelten vermag. Im Schlusswort gibt sie dem Ausdruck unter der Überschrift Durch die Ritzen der Verleugnung: Die Macht der Gefühle. Explizit pflichtet sie dem bei, was die Philosophin Agnes Heller als die innere Stimme bezeichnet, die über die Kraft verfügt, anderer Meinung zu sein, die eben nicht Stimme der Norm und der etablierten Theorien ist.
Eva Illouz Buch hebt sich erfreulich ab in seiner Offenheit gegenüber der Vielfalt von gedanklichen Positionen von Autoren, denen der gewählte Gegenstand zur Bestätigung einer Weltanschauung dient. Andere Standpunkte, seien sie nun traditionell religiöse, philosophische oder wissenschaftliche, werden von Illouz nicht schon im Vorfeld diskreditiert, und ihre Bezugnahme auf literarische Texte und Figuren macht die Lektüre ihres Buches zu einem höchst erfreulichen Erlebnis.