
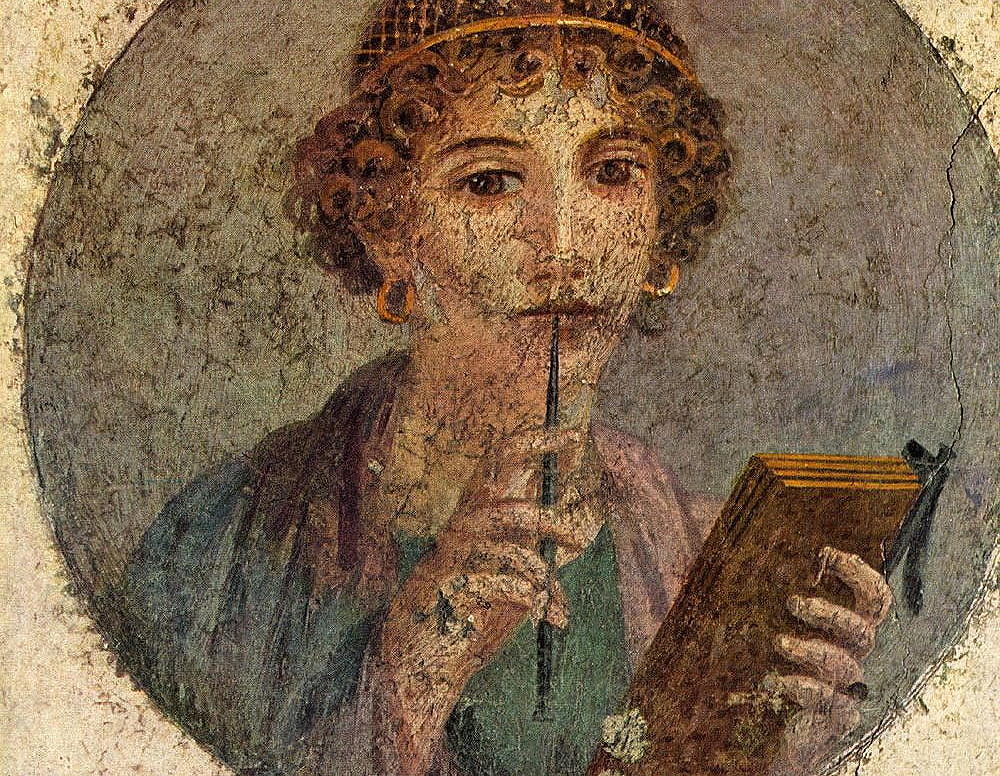

Diese verdammten liberalen Eliten: Wer sie sind und warum wir sie brauchen
| Autor*in: | Carlo Strenger |
|---|---|
| Verlag: | Edition Suhrkamp, Berlin 2019, 171 Seiten |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 12.08.2025 |
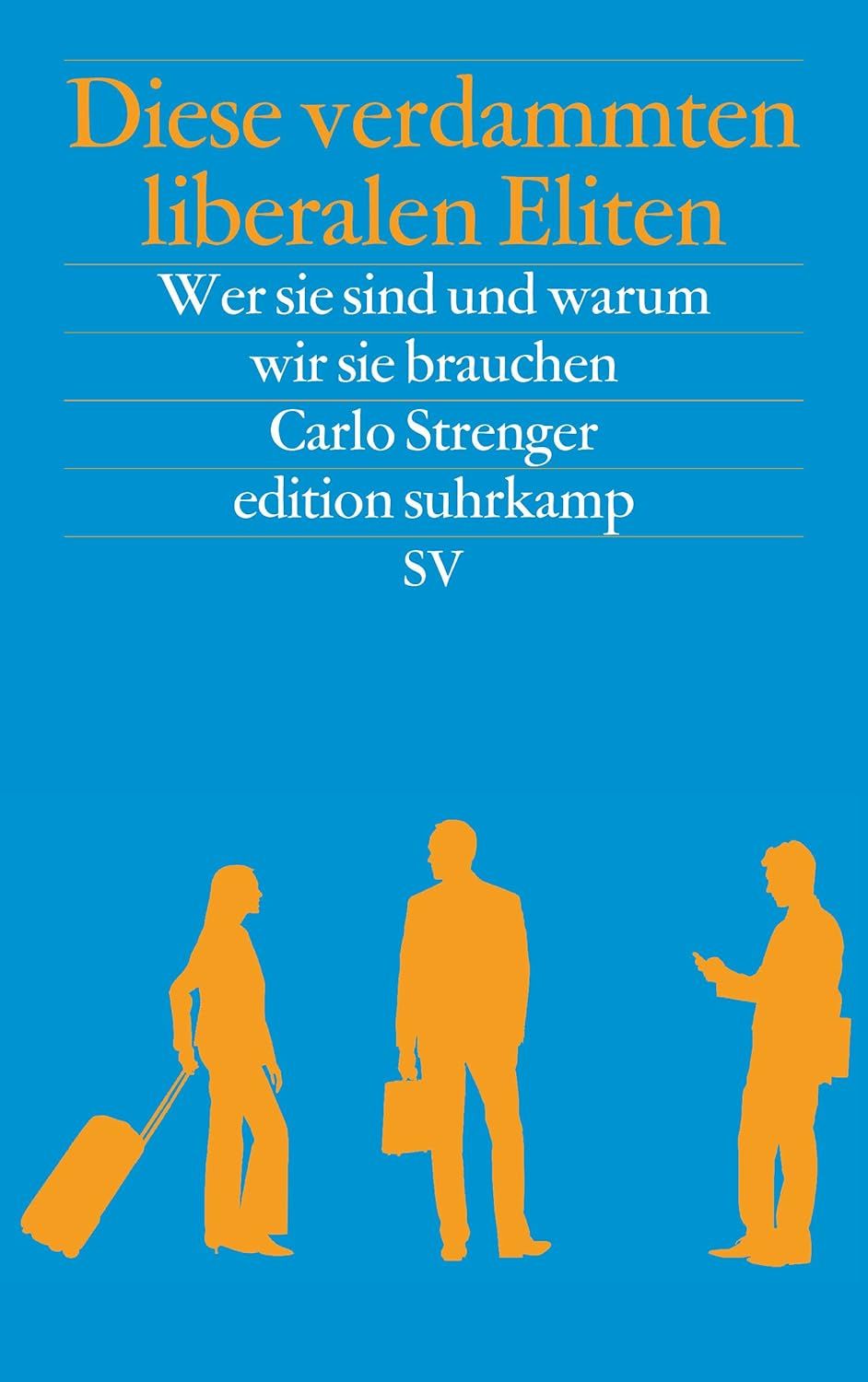
Carlo Strengers Essay Diese verdammten liberalen Eliten ist ein präziser, persönlicher und kultursoziologisch fundierter Blick auf eine global orientierte, gesellschaftliche Elite westlicher Staaten und zugleich eine leidenschaftliche Begründung für ihre Unverzichtbarkeit in demokratischen Gesellschaften. Wie schon der Amerikaner Richard Florida in seinem provokanten Buch The Rise of the Creative Class (2002/2019) identifiziert Strenger in modernen Gesellschaften einen Typus, der etwa 20 bis 30 Prozent der Erwerbsbevölkerung ausmacht. Diese Eliten sind hoch mobil, international vernetzt, arbeiten vielfach in kreativen Berufen und verfügen über ein ausgeprägtes „progressives“ soziales Gewissen. Anders als ökonomische Eliten streben sie weniger nach Geld als danach, „etwas Bedeutendes zu leisten“. Studien belegen, dass viele dieser Kosmopoliten linke und sozialdemokratische Werte vertreten, finanzielle Umverteilung befürworten und tiefes Mitgefühl für weniger privilegierte Gruppen aufbringen.
In seinem Buch zeichnet der schweizerisch-israelische Psychologe und Publizist Strenger fünf exemplarische Fallstudien aus seiner therapeutischen Praxis nach, die keine realen Personen sind, sondern typische Fälle darstellen sollen. Diese „Anywheres“ (Kosmopoliten) stehen kontrastierend zu den „Somewheres“ – stärker lokal verankerten Menschen. Der anthropologische Konflikt zwischen Weltoffenheit und Verwurzelung wird auf diese Weise anschaulich gemacht. Die Kommunikation zwischen global vernetzten Eliten und lokal verwurzelten Mehrheiten sei zusammengebrochen. Eliten würden oft als arrogant oder empathielos wahrgenommen; sie könnten nicht zuhören. Dies sei fatal, weil diese Lücke von populistischen Bewegungen gefüllt werde.
Der weitgereiste Strenger mit seinen vielfältigen wissenschaftlichen Beziehungen zählt sich selbst zu den „Anywheres“. Diese habe Andersdenkende, die sich bei den „Somewheres“ versammeln, häufig herablassend gegenübergestanden, sie als „dumm, indoktriniert oder provinziell“ abgestempelt, und damit einen Teil der aktuellen Polarisierung befördert.
Strenger schließt mit einem dringlichen Aufruf: Die liberalen Eliten müssten den Elfenbeinturm verlassen, sich der Öffentlichkeit stellen – etwa in sozialen Medien oder im Fernsehen – und Populisten dort argumentativ entgegentreten, wo ihre Botschaften am stärksten wirken. Zugleich solle Bildung in Schulen und Universitäten stärker staatsbürgerlich orientiert sein, damit breitere Bevölkerungsschichten als derzeit die liberal-pluralistische Demokratie verstehen und verteidigen können.
Das Buch wurde vielfach als klug, elegant und differenziert gelobt. Die literarische Welt rühmt das „wunderschöne, kluge, ungewöhnliche, differenzierte, feine, elegante, reife Buch“; der Tagesspiegel nennt Strenger einen Gegner des Relativismus und einen Fürsprecher der liberalen, sozialen Demokratie. Die Neue Zürcher Zeitung hebt die Dilemmata der Elite hervor, die Strenger erstmals so präzise beschreibt.
Das Dilemma der liberalen Eliten besteht im Spannungsfeld zwischen ihren eigenen Werten und ihrer gesellschaftlichen Wirkung. Auf der einen Seite sehen sich diese Eliten als Träger universeller, aufgeklärter Prinzipien wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, internationale Zusammenarbeit und wissenschaftsbasierte Politik. Sie verstehen sich oft als Motor des Fortschritts, kosmopolitisch und moralisch verpflichtet, globale Probleme wie Klimawandel, Ungleichheit oder autoritäre Tendenzen zu bekämpfen. Auf der anderen Seite werden sie von vielen Menschen als abgehoben, selbstreferenziell und bevormundend wahrgenommen. Ihre Lebenswelt – urban, hochgebildet, international vernetzt – unterscheidet sich stark von der vieler Mitbürger, was zu Entfremdung und Kommunikationsabbrüchen führt.
Das Dilemma ist damit doppelt: Wenn Eliten konsequent an ihren universalistischen Idealen festhalten, riskieren sie, sich weiter von Teilen der Bevölkerung zu entfernen und deren Ressentiments zu verstärken. Wenn sie hingegen versuchen, stärker populäre Positionen zu übernehmen oder nationale Identitätsmuster zu bedienen, laufen sie Gefahr, ihre eigenen Grundwerte zu verwässern und ihrer Rolle als Hüter liberal-demokratischer Standards untreu zu werden. Strenger beschreibt dieses Spannungsfeld als existenzielle Herausforderung (für die Eliten, nicht für die Normalbürger), weil eine Demokratie zwar auf engagierte, gebildete Eliten angewiesen ist, diese aber zugleich akzeptiert und als legitim anerkannt werden müssen – etwas, das im derzeitigen Klima politischer Polarisierung zunehmend schwerer zu erreichen ist.
Carlo Strengers Essay ist weit mehr als ein soziologisches Manifest. Er verbindet psychoanalytisches Feingefühl mit politischer Dringlichkeit. Die Stärke des Textes liegt in seiner Mischung aus Selbstkritik der Eliten und einem idealistischen Einsatz für die offene Gesellschaft. Obwohl strukturelle Analysen zu sozialen Milieus (z. B. Unterscheidung zwischen Wirtschaftseliten und kulturellen Eliten) etwas zu kurz kommen, eröffnet Strenger ein wertvolles Zugangsfenster zum inneren Befinden wichtiger gesellschaftlicher Akteure – und appelliert zugleich an die demokratische Verantwortung.
Das Buch ist ein geglückter Beitrag zur Debatte über gesellschaftliche Spaltung, Globalisierung und Populismus – und ein wichtiges Plädoyer fürs Zuhören und für mehr staatsbürgerliche Bildung. Strenger zeigt: Wir brauchen diese „verdammten liberalen Eliten“ – aber sie müssen den Dialog suchen.