
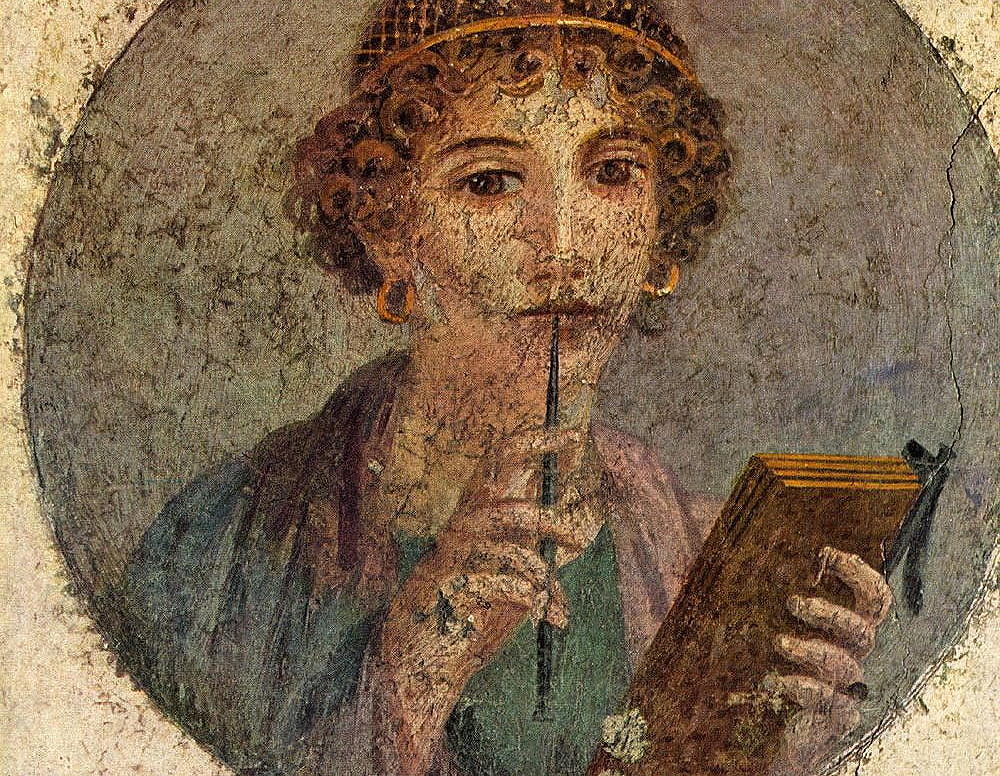

Das ideologische Gehirn. Wie politische Überzeugungen wirklich entstehen
| Autor*in: | Leor Zmigrod |
|---|---|
| Verlag: | Suhrkamp-Verlag, Berlin 2025, 302 Seiten |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 19.11.2025 |
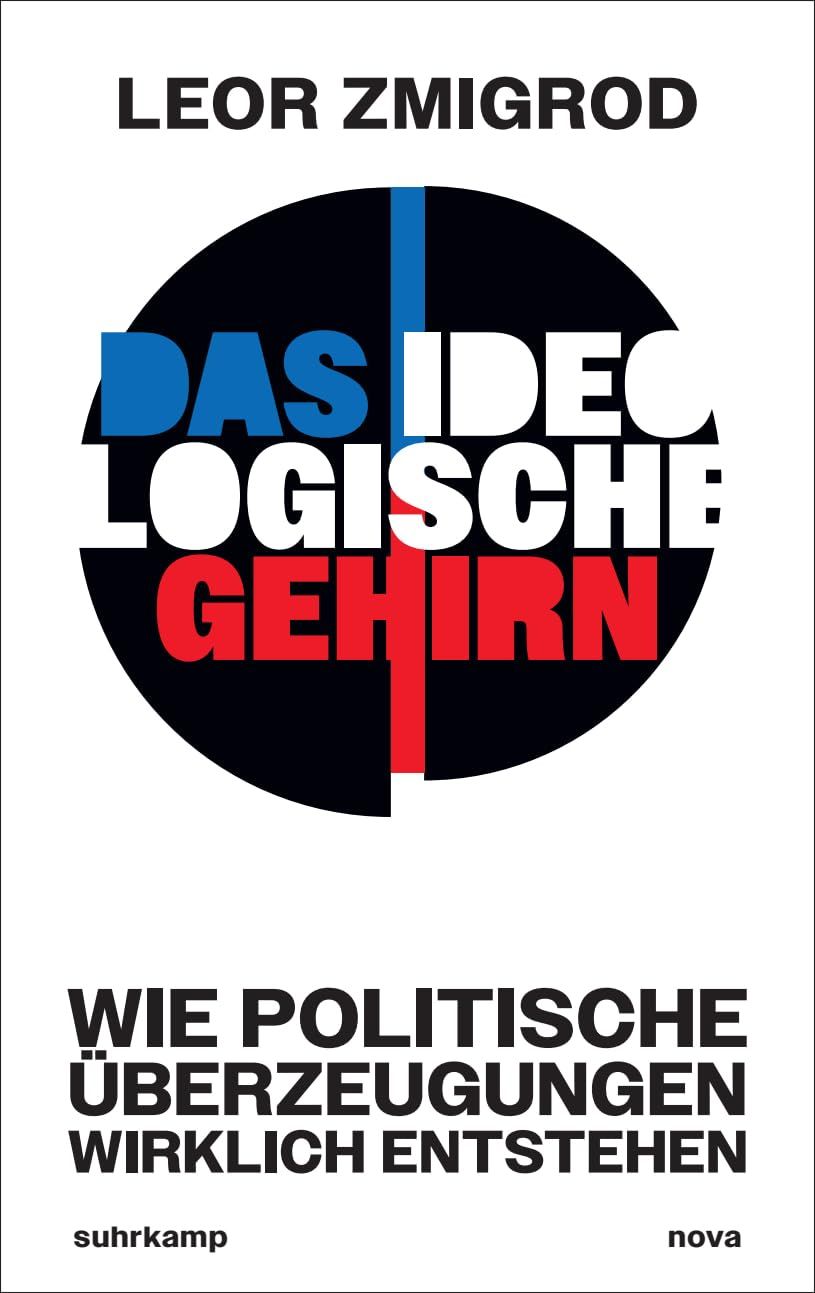
Leor Zmigrod ist eine vielfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin und Begründerin der „politischen Neurobiologie“. Seit 2019 forscht sie an der Universität Cambridge (GB). Sie war Visiting Fellow in Stanford, Harvard und Paris. Das Forbes Magazine listet sie als eine der 30 einflussreichsten Persönlichkeiten unter 30 Jahren auf. Sie gewann den Women of the Future Science Award, sie ist regelmäßig Beiträgerin für die BBC und den Guardian, trat in mehr als 50 Konferenzen auf, war Stipendiatin am Wissenschaftskolleg Berlin, berät als Expertin die UN, die britische und die US-amerikanische Regierung. Das ideologische Gehirn ist ihr erstes Buch, es wurde innerhalb von wenigen Tagen in hoher Auflage in mehr als 15 Länder verkauft.
Die wissenschaftliche Kritik ist begeistert von ihrem neuen Forschungsansatz, der die Lösung eines der drängendsten politischen Probleme verheißt: dem politischen Extremismus und der gesellschaftlichen Polarisierung. Die politische Neurowissenschaft ist – so der Anspruch – ein neues wissenschaftliches Feld, das Methoden der Neurowissenschaft, der kognitiven Psychologie und sogar der Genetik nutzt, um den Ursprüngen politischer Überzeugungen auf den Grund zu gehen. Warum sind manche Menschen besonders anfällig für ideologischen Extremismus? Das ideologische Gehirn bietet eine psychologische und biologische Perspektive, um zu verstehen, warum bestimmte Gehirne besonders empfänglich für extreme und dogmatische Ideologien sind und was andere Gehirne widerstandsfähiger gegenüber autoritären Weltanschauungen macht.
Die wissenschaftliche Senkrechtstarterin Zmigrod beschreibt und diskutiert in ihrem Buch (und in früheren Fachartikeln) eine Reihe etablierter psychologischer Verfahren, mit denen kognitive Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und damit potenziell ideologisches Denken gemessen werden kann. Ein Instrument zur Messung gedanklicher Flexibilität ist beispielsweise der Wisconsin Card Sorting Test (WCST). In dieser Aufgabe müssen Teilnehmer Karten nach wechselnden, nicht vorher vollständig bekannten Regeln sortieren. Sobald eine Regel geändert wird, zeigt sich, wie flexibel die Versuchsperson reagiert: Kann sie die Regeländerung erkennen und darauf adaptiv reagieren, oder bleibt sie starr bei der alten Regel? Zmigrod berichtet, dass Menschen mit stärker ausgeprägter ideologischer Rigidität (also Dogmatismus, Fixierung) häufiger Schwierigkeiten mit solchen Anpassungen zeigten.
Ein weiterer Test ist der Alternative Uses Test, bei dem Kreativität bzw. generative Flexibilität gemessen wird, z.B. viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten eines Gegenstandes zu benennen. Einfacher strukturierte Menschen sehen in einer Tasse nur ein Gefäß für Getränke, andere darüber hinaus einen Aufbewahrungsort für Kugelschreiber. Geringere Punktzahlen in solchen Tests korrelieren laut Zmigrod mit stärker rigidem ideologischem Denken.
Zmigrod bezieht sich auf Else Fraenkel Brunswick, die in die USA emigrierte und dort Hunderte von Kinder im Alter zwischen neun und 13 Jahren interviewte. Fraenkel Brunswick stellte sich die Frage: Was macht ein Kind zu einem potentiellen Faschisten? Wenn man Kinder genau betrachtet, könne man angeben, welche toleranter sind und welche schneller durch Autoritarismus verführt werden können. Sie konnte leicht die Unterschiede zwischen offenen und toleranten Kindern auf der einen Seite und engen und ängstlich-intoleranten Kindern auf der anderen Seite erkennen. Zmigrod führt an, dass Individuen mit niedriger Dopamin-Aktivität im präfrontalen Kortex und höherer Dopamin-Aktivität im Striatum eher rigides Denken zeigen, was wiederum mit ideologischer Anfälligkeit korreliert. Auch wenn genaue Angaben im Buch fehlen, spricht sie von biologischen Prädispositionen, die mit dem Belohnungssystem zusammenhängen. Bedeutet das, dass ideologische Ausrichtung schon in frühen Jahren vorhergesagt werden kann?
Die Befunde sind nicht wirklich neu. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer analysierten in den 1940er Jahren den Autoritarismus in der Tradition der kritischen Theorie und verbanden die psychologischen Ursachen mit der politischen und sozialen Struktur. Adorno entwickelte das Konzept der „autoritären Persönlichkeit“ mit Fokus auf psychologischen Wurzeln, die oft in einem rigiden Erziehungsstil entstehen und sich in antidemokratischen Tendenzen wie Konformität, Vorurteilen und Unterordnung unter Macht ausdrücken. Das Ergebnis der Big Five-Studien in den 1980er und 1990er Jahren unterteilt die menschliche Persönlichkeit in fünf Gruppen seelischer Eigenschaften, die über die Lebensspanne betrachtet relativ stabil sind. Tolerante Menschen sind offen für Erfahrungen, sind gewissenhaft, erkundungsfreudig und sozial verträglich und zeichnen sich nicht durch nervöse Überempfindlichkeit aus.
Wie sehen die kognitiven und emotionalen Muster aus, die einen Menschen mit extremer Ideologie auszeichnet? Zmigrods Ansatz ist es, nicht so sehr nach den Inhalten jeweiliger Ideologien zu schauen, sondern die Gemeinsamkeiten extremistischen Denkens zu benennen. Menschen, die einer starken Ideologie anhängen, haben fixe Doktrinen, gefasst in moralische Regeln. Sie wissen genau, was richtig und was falsch ist. Ihre moralischen Regeln fassen sie als absolut auf. Ihre Doktrin widersteht jeglichen Fakten.
Das ist der Unterschied zwischen Ideologie und Wissenschaft. Die Wissenschaft inkorporiert Fakten, strikte Ideologien tun das nicht. Ideologische Denker sind stark darauf angewiesen, dass ihre Ideen nicht infrage gestellt werden. Sie sind aggressiv darauf eingestellt, ihre rigide Kognition zu verteidigen. Sie hassen alle Tatsachen, die ihre Regeln verändern könnten. Sie verweigern sich der Anpassung, wenn sie feststellen, dass sie das Spiel nicht mehr richtig mitspielen können. Die extreme Linke und die extreme Rechte sind ideologisch am starrsten. Die Mittelgruppe ist kognitiv flexibler. Je rigider die Kognition, desto stärker die Tendenz zu extremistischen Ideologien. Jede Ideologie versucht, sich selbst zu schützen, indem sie sich gegen Widersprüche immunisieren. Ideologien koordinieren, sie geben Struktur vor, auch das ist oftmals wichtig für das menschliche Leben.
Aber werden Offenheit oder Verschlossenheit, Flexibilität und Rigidität nicht auch durch die Familie festgelegt, genauer gesagt durch die Interaktionen innerhalb der Familie? Ist Extremismus genetisch vorgegeben oder gibt es eine Beziehung zu der Art und Weise, wie Beziehungen geführt werden? Es ist nicht klar, ob z. B. eine große Amygdala Menschen ideologischer macht oder ob Umwelteinflüsse (soziales Milieu, Trauma, Kultur) Gehirnstrukturen und Ideologie gemeinsam beeinflussen. An dieser Stelle werden die scheinbar so klaren Thesen Zmigrods verwaschen und undeutlich. Gibt es erst eine Gehirnstruktur, aus denen linkes oder rechtes Gedankengut entsteht? Oder bildet sich das Leben in einem Umfeld des Extremismus im Gehirn ab? Was ist Huhn, was ist Ei? Sowohl Genetik als auch Umwelt prägen das Gehirn – das, was einer mitbringt, und die Einflüsse, unter denen er aufwächst. Es ist also nicht nur das Gehirn, das sich auf das politische Denken auswirkt, sondern ebenso sind es die Erfahrungen, die dieses Gehirn später verarbeitet.
Wenn also beide großen Einflussfaktoren gleichermaßen berücksichtigt werden müssen, was bedeutet das für etwaige Schlussfolgerungen? Zmigrod nimmt mitunter die situativen, sozialen und historischen Einflüsse zu wenig in den Blick. Die Transformation biologischer Befunde in konkrete Handlungs- oder Präventionsstrategien steht noch aus. Die Autorin plädiert für Offenheit und Flexibilität im Denken. Das wäre eine Aufgabe für Kindergarten und Schule. Wissenschaftler und Demokraten sind keine Eiferer. Sie werden nicht laut, sie argumentieren nicht dogmatisch, sie bleiben freundlich und diskussionsbereit. Menschen mit Empathie sind weniger ideologisch, weil sie die andere Seite verstehen können, eben weil sie tolerant sind.
Das ideologische Gehirn öffnet den Blick darauf, wie tief Ideologien in den kognitiven und biologischen Strukturen unseres Denkens verankert sind – nicht als Vorbestimmung, aber als Risiko- und Vulnerabilitätsfaktor. Durch gutes Zureden allein wird man extremistisch und dogmatisch denkende Menschen nicht überzeugen können. Gesellschaften, die geistige Flexibilität, Ambiguitätstoleranz und Perspektivwechsel fördern, sind weniger anfällig für Extremismus. Praktisch bedeutet das, dass Bildungs- und Kulturpolitik stärker auf kritisches Denken, kognitive Offenheit und soziale Empathie zielen sollte, anstatt primär gegen Ideologien anzukämpfen. Überzeugungen sind emotional und neurobiologisch verankert; sie lassen sich nicht allein durch rationale Argumente auflösen, sondern erfordern emotionale und soziale Ansprechbarkeit.
In der Psychotherapie werden rigide und ideologisch aufgeladene Denkstile als Abwehr gegen Unsicherheit gedeutet – eine kognitive und affektive Vermeidung von Ambivalenz und Unsicherheit. Therapeutisch bedeutsam wäre deshalb, die Fähigkeit zu kognitiver Flexibilität und Affekttoleranz zu stärken. Besonders in der tiefenpsychologischen Arbeit kann die Förderung von Selbstreflexion, Meta-Kognition und komplexem Denken als Gegenpol zu dogmatischer Selbstvergewisserung verstanden werden.
Zmigrod selbst warnt allerdings vor Überinterpretation: Ihre Befunde erklären nur statistische Zusammenhänge, keine individuellen Schicksale. Neurobiologische Prädispositionen sind keine Schicksalsdeterminanten. Für politische oder therapeutische Praxis lassen sich daher eher Leitgedanken als Rezepte formulieren: Ihre Forschung liefert kein Instrumentarium, um „ideologische Gehirne“ zu erkennen oder zu korrigieren, wohl aber einen theoretischen Rahmen, um Verhärtungen im Denken besser zu verstehen und sie auf kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene gezielt zu lockern.