

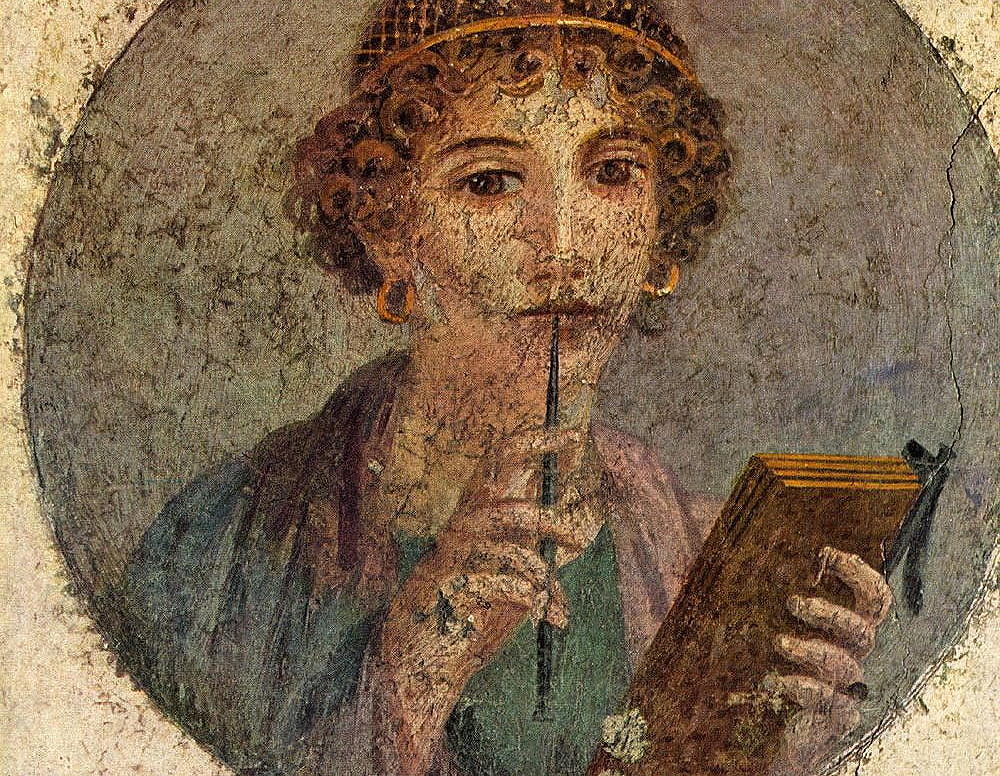
Rezensionen Tiefenpsychologie
und Kulturanalyse
The Lives of Erich Fromm. Love’s Prophet
| Autor*in: | Lawrence J. Friedman |
|---|---|
| Verlag: | Columbia University Press, New York, 2013, 410 Seiten |
| Rezensent*in: | John Burns |
| Datum: | 02.10.2025 |
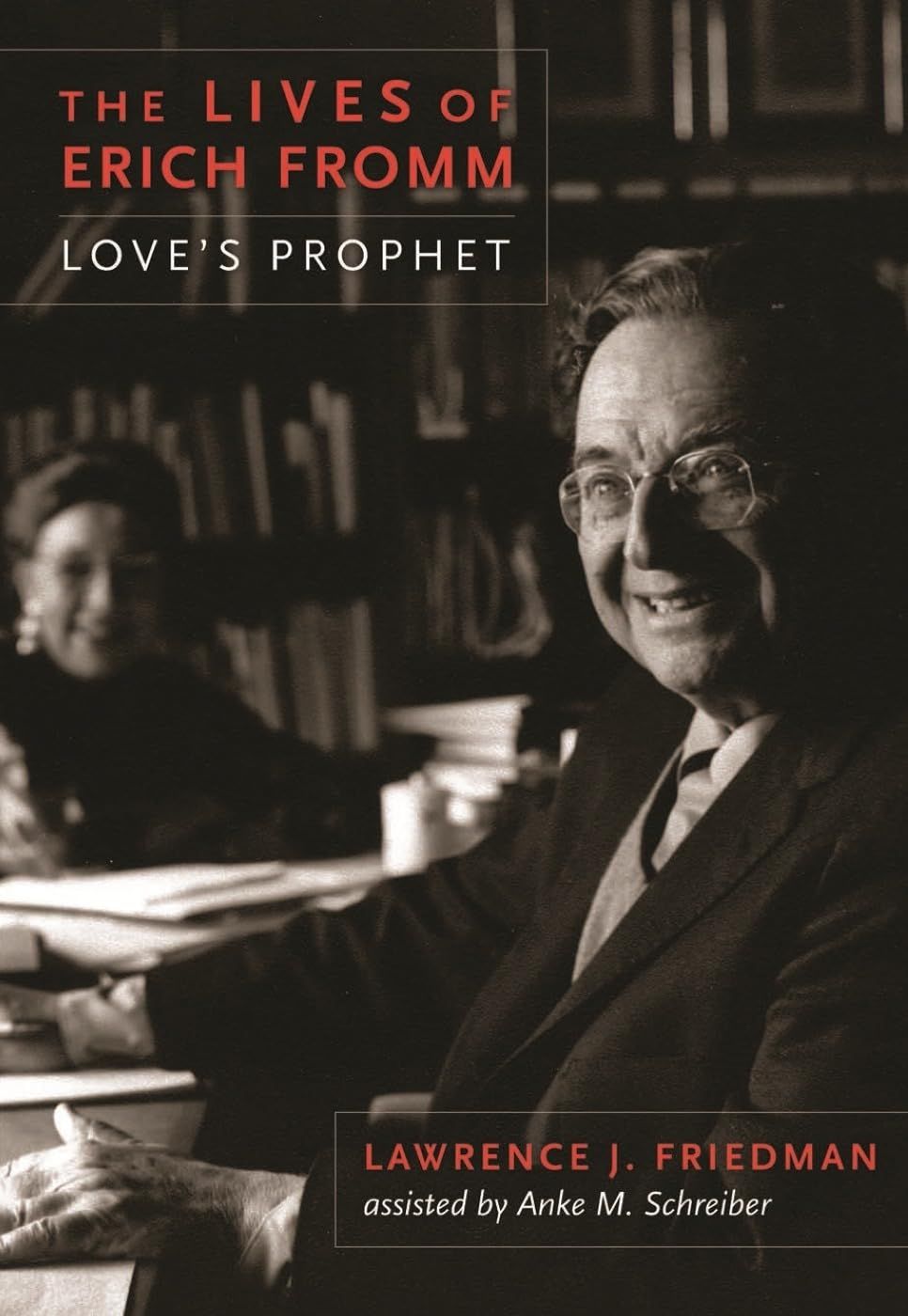
Erich Fromm wurde als einziger Sohn des Ehepaars Rosa und Naphtali Fromm im Jahre 1900 in Frankfurt am Main geboren. Er fühlte sich als Kind von seinen Eltern sehr bedrängt, da er eine Vermittlerrolle zwischen seiner depressiven Mutter und seinem geschäftsuntüchtigen Vater einnahm, die eine unglückliche Ehe führten. Fromm war ein intelligenter Junge, der sich schon früh für die schriftlichen Überlieferungen des Judentums interessierte. In seinen jungen Jahren wurde er von den Rabbinern und Talmudgelehrten stark beeinflusst, an deren Lern- und Lesezirkeln er als Schüler teilnahm. Beide Eltern des lernbegierigen Heranwachsenden stammten aus Rabbinerfamilien.
Von der Mutter verwöhnt und vom Vater ängstlich beschützt, rettete sich Fromm vor den möglichen Folgen eines ödipalen Konflikts in die geistige Sphäre. Nach dem Abitur studierte er zunächst einmal Jura in Frankfurt am Main, wechselte aber dann nach Heidelberg, wo er sich für die Fächer Soziologie, Psychologie und Philosophie einschrieb. Er promovierte 1922 mit einer Dissertation über Das jüdische Gesetz beim Soziologen und Nationalökonomen Alfred Weber, dessen Bruder Max Weber mit seinem Werk Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1920) über Deutschland hinaus bekannt wurde.
Fromm, dessen Bücher Die Furcht vor der Freiheit (1941) und Die Kunst des Liebens (1956) ihn zu einem der meist gelesenen populärwissenschaftlichen Psychotherapeuten werden ließen, entdeckte früh seine intellektuelle Begabung. Er war optimistisch und aufgeschlossen, neugierig und ehrgeizig, so dass er zu anderen Intellektuellen seiner Generation leicht Kontakt bekam.
Im späteren Leben genoss er in den USA, wohin er 1933 ins Exil ging, den Ruf eines public intellectual. Fromm vertrat einen engagierten, nicht-theistischen, sozialen Humanismus und prangerte alle Missstände in den USA an, die seiner Meinung nach auf die Konsumgesellschaft und die Vernachlässigung der Spiritualität des Menschen zurückzuführen waren. Wie er in seinen Schriften stets betonte, sei der Mensch und nicht der kapitalistische Wettbewerb Mittelpunkt der Welt.
Fromm war während des Kalten Krieges um die Zukunft des Menschen sehr besorgt, die er durch das atomare Aufrüstung der Großmächte als stark gefährdet betrachtete. In dieser Hinsicht weist Lawrence J. Friedman in der Einleitung zu seiner breit angelegten Studie The Lives of Erich Fromm. Love’s Prophet auf die vielen Rollen des einstigen Mitglieds des renommierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung hin, der mit Fleiß und Elan zum Erfolgsautor avancierte.
Fromm war Laienanalytiker, der sein therapeutisches Handwerk durch Lehranalysen bei renommierten Freudschülern wie z.B. Hans Sachs erlernte. Die orthodoxen Freudianer imponierten ihm weniger als der innovative Leiter eines Sanatoriums in der Villa Marienhöhe in Baden-Baden, Georg Groddeck. Für seine spätere psychotherapeutische Praxis waren seine erste Ehe mit der um 11-Jahre älteren Psychiaterin Frieda Reichmann und seine Bekanntschaft mit Karen Horney von großer Bedeutung, weil sie schon über reichlich klinische Erfahrung verfügten.
Fromm war nicht nur Psychoanalytiker, sondern zählte zu den Gründungsmitgliedern des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, an welchem er sein theoretisches Amalgam aus Marxismus, Psychoanalyse und Mutterrechtstheorie auf die Familienverhältnisse der Weimarer Republik „am Vorabend des Dritten Reichs“ anwandte.
Friedmann zeigt in seiner Biographie auf, wie sehr Fromm schon zu Beginn seines Forscher- und Analytiker-Lebens um eine ihm schlüssig erscheinende Kulturtheorie bemüht war. Anregung für seine Forschung fand er in der Weimarer Zeit vor seiner Auswanderung in die USA genug, als die jüngere Generation der Psychoanalytiker die Libido-Theorie Freuds in Frage stellte.
Die Soziologen und Politologen dagegen opponierten gegen die messianische Auslegung des Marxismus. Hierzu machten sie z.B. Anleihen beim Schweizer Anthropologen J.J. Bachofen (1815-1887), dessen spekulative Mutterrechtstheorie die tradierte Auffassung hinterfragte, dass es das Patriarchat schon immer gegeben habe.
Fromm, der ausgebildete Soziologe unter den Analytikern, war wie Karen Horney und Harry Stack Sullivan der Meinung, dass der Mensch ein soziales Wesen sei, dessen seelische Anomalien nicht nur individuell verstanden werden können. Der Mensch entwickle während seiner Familiensozialisation, dachte Fromm, nicht nur individuelle Eigenschaften, sondern auch einen Gesellschaftscharakter.
Der Mensch habe in seiner Kindheit sicherlich eine psychosexuelle Entwicklung zu absolvieren, wie Fromm erläuterte; er lerne aber auch in jungen Jahren, seine soziale Umgebung zu assimilieren und sich darauf zu beziehen. Indem er sozial werde, werde er für die Gesellschaft, in der er lebe, nützlich. Je nachdem, wie seine Angst- und Affektbewältigung gelungen oder misslungen sei, wähle er seine soziale Rolle in Arbeit und Freizeit, oder er bekomme die soziale Rolle zugeschanzt, welche die ökonomische Struktur der Gesellschaft für ihn bereithalte.
So könne Verwöhnung in einer frühen Entwicklungsphase einen Menschen dazu prädisponieren, ein orales Suchtverhalten zu entwickeln, die ihn zum mustergültigen Konsumenten in der Wohlstandsgesellschaft werden lasse, dachte Fromm. Ein narzisstischer Mensch sei nach den soziologischen Beobachtungen Fromms unter Umständen ein gewissenloser Unternehmer, der als Manager eines Konzerns arbeite, ohne sich für die Belange seiner Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen zu interessieren. Er könne, wie Willy Loman in Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Miller, Seidenstrümpfe verkaufen, seine Frau betrügen und seinen Söhnen vom amerikanischen Traum erzählen, weil er nur für sein Produkt und seine Firma Verantwortung trage. Seine eigene moralische Integrität habe der Familienvater in Millers Theaterstück schon längst eingebüßt.
Kurz vor seinem Tod an einem Herzinfarkt im Jahre 1980 konnte der weltberühmte Psychotherapeut und Autor Erich Fromm auf ein erfolgreiches produktives Leben zurückblicken. Wie ein roter Faden verläuft aber durch das Leben des renommierten Sozialkritikers ein religiöses Sendungsbewusstsein, das auf Wissenschaftler wie Friedmann befremdlich wirkt. Könnte es sein, fragt der Autor, dass Fromm sich von den inneren Dämonen, die er seit seiner Frankfurter Kindheit zu kompensieren versuchte, stets gefährdet fühlte? Fromm habe auch menschliche Schwächen, meint Friedman, die er mit seinem manischen Arbeitseifer, Erfolgsdrang und grenzenlosem Optimismus zu überspielen trachte.
Fromm vertrat eine buddhistische, nicht-theistische Lehre, die auf einfachen Dichotomien aufbaute, wie z.B. in Psychoanalyse und Ethik (1947) seine Unterscheidung zwischen einem humanistischen und einem autoritären Gewissen. In der Sozialkritik wies Fromm immer wieder auf das Begriffspaar Haben oder Sein hin; in der Psychopathologie sind wir entweder krank oder gesund, nekrophil oder biophil.
Unter Biophilie verstand Fromm die Liebe zum Leben. Während in der Sexualtheorie Freuds der Charakter als Reaktionsbildung auf der Triebstruktur des Menschen entstehe, räumte Fromm der sozialen Bezogenheit des Heranwachsenden eine größere Bedeutung als in der orthodoxen Psychoanalyse ein. Fromm war der Meinung, dass sich eine reife Persönlichkeit durch eine ethische Haltung auszeichne, die er als Biophilie bezeichnete.
Der von Fromm geprägte Begriff enthielt Assoziationen zur ethischen Haltung Albert Schweitzers, dessen Lebensgestaltung von seiner Ehrfurcht vor dem Leben zeugte. Biophilie nach Fromm umfasste ein breites Spektrum an vitalen und materiellen Werten. Der Begriff hatte auch Konsequenzen für die Psychotherapie, die Fromm und seine Schüler praktizierten. Das vom Gesprächspsychotherapeuten Carl Rogers empfohlene therapeutische Verhalten des empathischen Hörens scheint mit der Haltung Fromms Ähnlichkeit zu haben.
Im therapeutischen Setting sollen Therapeut und Patient eine therapeutische Beziehung von Wesenskern zu Wesenskern anstreben. Fromm bezeichnete diese Haltung als central relatedness. Wie das in der Wirklichkeit praktiziert wurde, und was einen biophilen Menschen ausmacht, wusste am besten der Praktizierende selbst, der hierüber schrieb:
„Die Psychologie wird zum Liebesersatz, zum Ersatz für Intimität, für die Vereinigung mit anderen und mit sich selbst; sie wird zur Zuflucht für den einsamen, entfremdeten Menschen, statt dass sie ein Schritt zur Vereinigung ist“ (Fromm 1957a, in GA VIII, 25).
Lawrence J. Friedman hat eine sehr lesenswerte Studie vorgelegt, die auf zeitaufwendigen genauen Recherchen beruht. Es gelingt ihm bei aller Wertschätzung Fromms eine kritische Distanz zu seinem Thema zu wahren, so dass er die Selbststilisierung Fromms wohlwollend hinterfragen kann. Fromm war eben ein homo religiosus, dessen Weltanschauung in seinen späteren Schriften seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu überwuchern drohte.
Interessanterweise besann sich Fromm mit einem seiner letzten Bücher Die Anatomie der menschlichen Destruktivität (1973) auf seine ursprüngliche wissenschaftliche Haltung, indem er das Phänomen Aggression wie in seinen jungen Jahren als kritischer Denker am Frankfurter Institut für Sozialforschung in allen Facetten zu erfassen versuchte. Hierin bewegte sich der Neopsychoanalytiker Erich Fromm wieder auf seinen einstigen Mentor Sigmund Freud zu, der in Die Zukunft einer Illusion (1927) formulierte: „Nein, unsere Wissenschaft ist keine Illusion. Eine Illusion aber wäre es zu glauben, dass wir anderswoher bekommen könnten, was sie uns nicht geben kann“ (Freud 1927, 188).
Literatur:
Freud, S.: Die Zukunft einer Illusion (1927). In: Studienausgabe Bd. IX, Frankfurt a. M., 1974.
Funk, R. (Hrsg.): Erich Fromm Gesamtausgabe, Bd. VIII, München 1981.