

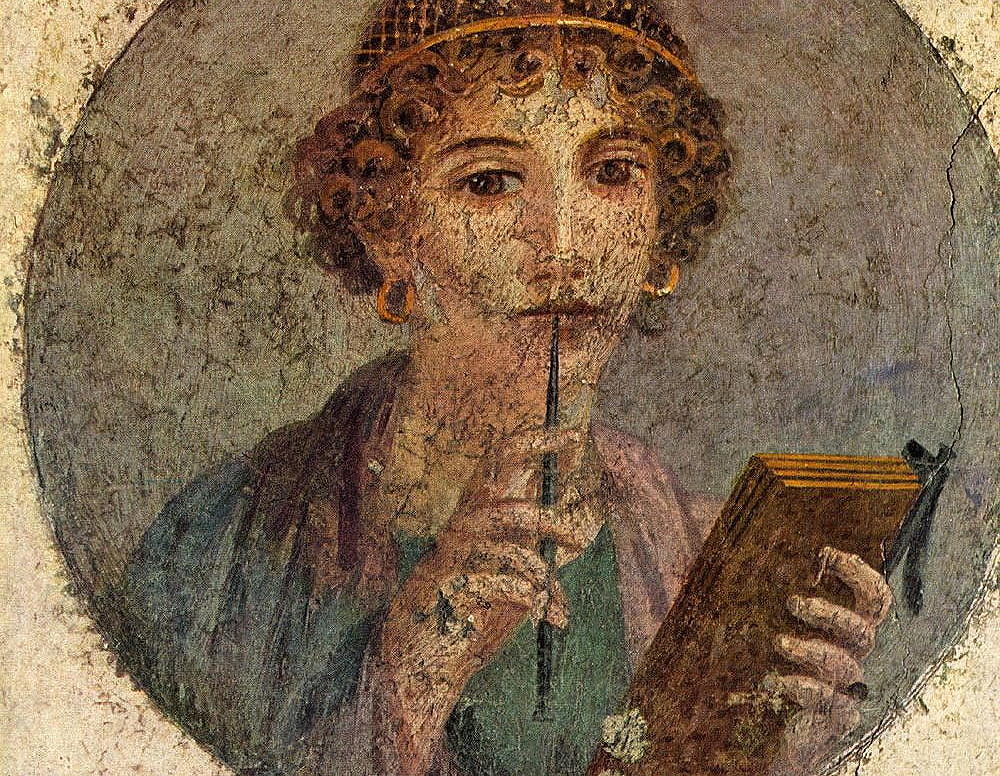
Rezensionen Tiefenpsychologie
und Kulturanalyse
Macht. Psychoanalytische Betrachtungen
| Autor*in: | Sabine Schlüter/ Rainer Gross (Hrsg.) |
|---|---|
| Verlag: | Brandes und Apsel, Frankfurt am Main 2025, 222 Seiten |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 07.07.2025 |

Nach einer viel zitierten Definition von Max Weber bedeutet „Macht jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ (1922). Die Psychoanalyse habe sich des Themas zu selten angenommen, meinen die Herausgeber des Tagungsbandes Macht, Sabine Schlüter und Rainer Gross. Beide sind zentrale Figuren in der Wiener Psychoanalytischen Akademie. Der Band vereint die 19 Beiträge der Sigmund-Freud-Vorlesungen 2024. Diese Vorlesungen finden jährlich in Wien am 6. Mai, dem Geburtstag Sigmund Freuds, statt.
Der Untertitel des Bandes lautet Psychoanalytische Betrachtungen, was den Leser darauf vorbereiten sollte, dass er zum Thema Macht in gesellschaftlichen Beziehungen eher lockere Überlegungen denn stringente Analysen zu erwarten hat. Im Grunde genommen handelt es sich um ein ausuferndes Thema, ist doch jede Beziehung Machtaspekten unterworfen. Sich mit dem Thema Macht zu beschäftigen wird behindert durch das Vorurteil, dass Macht „an sich böse“ sei - ein wiederkehrendes Thema in der Philosophie und Literatur. Friedrich Nietzsche vertrat mit seinem Werk Jenseits von Gut und Böse eine gegenteilige Position. Seine These und weitere mögliche positive Aspekte von Macht tauchen in dem Sammelband nicht auf. Seine Autoren konzentrieren sich auf die kritikwürdigen Seiten der Macht, die zudem oftmals mit „dem Kapitalismus“ und der Warenwelt kurzgeschlossen werden, als ob es in anderen Gesellschaften keine Machtausübungen gäbe.
Sicherlich, Macht kann missbraucht werden, aber das ist nicht sein einziger Aspekt. Geld bedeutet Macht im Sinne von Handlungsfreiheit, mehr Geld bedeutet mehr Freiheit. Besonders segensreich ist die Staatsmacht mit ihrem Gewaltmonopol, die entscheidend zur Eindämmung von Machtmissbrauch beigetragen hat. Menschen insbesondere in den westlichen Ländern leben so sicher wie noch nie in ihrer Geschichte. Der moderne Staat kennt viele Mechanismen, darunter Gesetze, Polizei und Justiz, die Macht begrenzen oder ihren Einsatz lenken. Man kann sein Geld für wohltätige Zwecke einsetzen. Und nicht zuletzt sind jene Fälle zu beachten, in denen Menschen mehr oder weniger bewusst auf öffentlich sichtbare Macht und entsprechenden Einfluss verzichten – weil sie es sich nicht zutrauen oder weil sie anderes für wichtiger halten. Andere wiederum sind unfähig, sich gegen Machtansprüche und Angriffe zu verteidigen. Nicht zuletzt gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob Macht und Gewalt legitim oder illegitim sind, ob man sie akzeptieren sollte (staatliche Gewalt beispielsweise) oder es Zeit ist, zu rebellieren. Es gibt nicht nur Machtmenschen, sondern auch Ideen und Meinungen, die hegemonial werden können, und gegen die man schlecht ankommt. Macht kann konstruktiv und destruktiv sein. Politik ist auch der Versuch, divergente Machtblöcke auszutarieren. Die derzeit grassierende Opfermentalität in vielen gesellschaftlichen Gruppen geht unhinterfragt aus von Machtlosigkeit und verweigerter Anerkennung. Neben der Bereitschaft, sich Autoritäten unterzuordnen, gibt es ebenso die Bereitschaft, gegen sie zu rebellieren. Alles das taucht bei Schlüter und Gross nicht einmal am Rande auf.
Die Autoren fokussieren ganz auf die negativen Aspekte. Wer wenig gesellschaftliche Macht hat, wird geneigt sein, sich mit der Macht anderer zu identifizieren. Das ist – auch in diesem Buch – eine gängige Erklärung für das Erstarken rechtspopulistischer Parteien. Im Kapitalismus, so Eveline List (Universität Wien), dominiert die ökonomische Macht, und es bleiben nur wenige machtlose Gruppen und Kulturen übrig. Die vielen Möglichkeiten der (politischen) Artikulation existieren für sie nicht, während die „Ohnmachtserfahrung“ dominant sei. Und selbst wer in einer relativ gewaltfreien Gesellschaft lebt, trage verinnerlichte Machtkonstellationen mit sich herum. Klaus Posch hebt einseitig auf die Durchsetzung von Macht durch Gewalt, Herrschaft, Drohung und Gehorsam ab. Überredung, Verlockung, Schmeichelei, Zuwendung und Versprechen scheinen für ihn keine Mittel zu sein, Machtvorstellungen durchzusetzen.
Für Sigmund Freud hatten alle Symptome einen tieferen psychologischen Sinn. Seine Psychoanalyse hat auch einen Machtaspekt, indem Patienten durch Aufdeckung Macht über ihre Psyche zurückgegeben werden sollte. Damit beschäftigt sich Bernd Nitzschke (Düsseldorf). Um Macht über sich zurückzugewinnen, bedürfe es der Selbstbeherrschung. Das wiederum bedeutet, seine Affekte regulieren zu können. Karl Fallend erinnert an das Leben der ersten Kinderanalytikerin Hermine Hug-Hellmuth, die von ihrem Neffen Rudolf ermordet wurde. Elisabeth Skale fächert Allmachtsfantasien und Ohnmachtsgefühle von Heranwachsenden auf. Insbesondere die Einschränkungen der Corona-Pandemie hätten Jugendliche in ihrer schwierigen Entwicklungsphase traumatisch belastet.
Ist von negativer Macht die Rede, dann ausschließlich auf Seiten des Faschismus, des Nationalsozialismus, rechtspopulistischer Parteien und autoritärer Führerbewegungen. Linke Ideologien, Kommunismus und religiöser Fanatismus werden nur am Rande erwähnt. Dabei ist das seelische Prinzip ihrer Gefolgschaft identisch: das Prinzip der Aufwandsersparnis, d.h. unter möglicher Vermeidung psychischer Konflikte das höchste Maß an Befriedigung zu erreichen. Es gibt einen psychischen Gewinn durch Unterwerfung unter Anordnungen und Befehle. Damit wird man Über-Ich-Anforderungen gerecht. Ein weiterer narzisstischer Gewinn entsteht durch die Straffreiheit aggressiver Handlungen. Gewalt gegen Feinde darf sich ungehemmt und ungehindert äußern. Die kollektiven sozialen Medien kommen den unterschwellig vorhandenen Wut- und Mordfantasien entgegen. Diese Inhalte dringen in die Seelen ein, so wie es die Nazi-Propaganda tat.
Was könnte dem entgegengesetzt werden? Elisabeth Brainin und Samy Teicher bleiben vage. Sie sprechen von der nötigen Qualitätsprüfung digitaler Inhalte. Social Media und Künstliche Intelligenz bieten Menschen eine nie dagewesene Chance, kinderleicht an sicheres Wissen und Informationen heranzukommen. Es ist möglich, innerhalb von Minuten Fake News zu entlarven. Warum wird das nicht genutzt? Dazu bedarf es einer inneren Bereitschaft und eines moralischen Kompasses. Wie wäre dieser zu definieren? Die Menschheit war in der Lage, in den vergangenen 200 Jahren ungeheure technische Fortschritte zu realisieren, „auf dem Gebiet des Seelenlebens hat sich dann doch nicht allzu viel verändert“ (Brainin/Teicher, S. 111).
Um Gründe für die Beliebtheit autokratischer Bewegungen zu nennen, werden praktisch alle Phänomene des modernen westlichen gesellschaftlichen Lebens angeführt: Globalisierung, Migration, Klimawandel, Neoliberalismus, Wohlstandsschere, Internet, Identitätspolitik ... „Die Psychoanalyse trägt mit ihrer Begrifflichkeit von pathologisch-narzisstischen Führertum, paranoiden gesellschaftlichen Regressionsprozessen und der nur bedingten Kulturtauglichkeit des Menschen aufgrund seiner Triebausstattung auch nicht gerade zur Aufhellung der Stimmung bei“, schreibt Anna Leszczynska- Koenen (S. 131). Sie erzählt die Geschichte der polnischen Gesellschaft vom Wahlsieg der nationalkonservativen PiS 2015 bis zum Wahlsieg der demokratischen Opposition im Oktober 2023. PiS, die Abkürzung bedeutet „Recht und Gerechtigkeit“, sei eine Verhöhnung der Realität. Die PiS vermochte es, mit Mitteln der Demokratie diese in eine Farce zu verwandeln. Es ist eine Illusion anzunehmen, das sogenannt einfache Volk habe eine untrügliche Witterung für das Echte und Aufrichtige. Trump ist nicht trotz, sondern wegen seiner billigen Possen beliebt, wegen seiner falschen Töne und seiner Clownerien, an denen sich ein Großteil des Publikums ergötzt. In der demokratischen Öffentlichkeit Polens, der USA und anderer Staaten macht sich Verzweiflung breit: Wie kann dieser Lawine aus Hass, Rache und Ressentiments widerstanden werden?
Esther Hutfless (Linz) beschäftigt sich mit Intersektionalität, der Verdoppelung und Verdreifachung von ohnehin schon bedrückenden Formen der Diskriminierung ins Unerträgliche. Der Begriff wurde in den 1980er Jahren von der Juristin und schwarzen Feministin Kimberlé Crenshaw geprägt, um die Mehrfachdiskriminierung schwarzer Frauen zu beschreiben, die sowohl von Rassismus als auch von Sexismus betroffen sind. Speziell Homosexuelle scheinen zum Leiden geboren. Eine Gegenwehr scheint unmöglich. Fritz Lackinger (Klagenfurt) kann irrationales Wählerverhalten wieder nur auf den neoliberalen Kapitalismus zurückführen. Die liberalen Führungsschichten hätten systembedingt versagt. Gibt es also einen guten Grund, rechts und rechtsextrem zu wählen?
Die Analyse fast aller 18 Autoren ist einseitig und alarmistisch. Positive Erfahrungen werden grundsätzlich ausgeblendet, Lebenszufriedenheit, Solidarität oder gegenseitige Unterstützung praktisch nicht thematisiert. Was bedeutet es, „einen furcht- und illusionslosen Blick auf die innere und äußere Realität zu richten“ (Leszczynska-Koenen, S. 143)? Die moderne Psychoanalyse scheint nicht über das Instrumentarium dafür zu verfügen. Eine grundsätzlich negative Haltung ist durchaus gängig in unserer Gesellschaft; die Psychoanalyse schwimmt insofern im Strom mit. Zur Realität gehört die Verschiedenheit der Menschen in sämtlichen Aspekten, auch der Anwendung von und der Verführbarkeit durch Macht. Zur Realität gehören aber auch die guten und befriedigenden Seiten des menschlichen Zusammenlebens. Dieser Aspekt wäre dialektisch abzuwägen gegen die problematischen Entwicklungen. Die Psychoanalyse kann nur immer wieder betonen, dass das „Ich nicht Herr ist im eigenen Haus“ (Freud, 1923). Haben wir nicht alle eine Neigung zur regressiven Idealisierung und den Wunsch nach einem mächtigen Objekt, das uns vor den Widrigkeiten des Lebens und der Realität beschützen möge? Viele Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen werden von unbewussten Prozessen gesteuert, die selten bewusst wahrgenommen oder kontrolliert werden können. Die Psychoanalyse kann lediglich anbieten, einzelnen Patienten zu mehr Aufklärung über ihr Unbewusstes zu verhelfen. Das wird das Ruder der Entwicklung nicht herumreißen.