

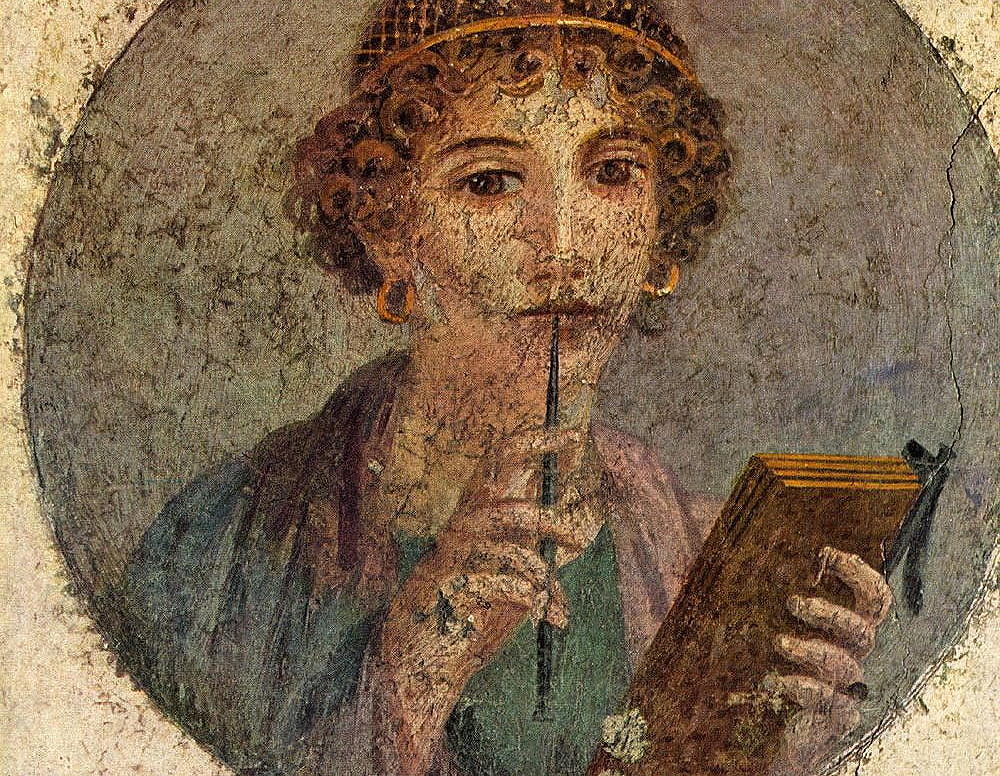
Rezensionen Tiefenpsychologie
und Kulturanalyse
Kampf ums Unbewusste - Eine Gesellschaft auf der Couch
| Autor*in: | Christina von Braun/Tilo Held |
|---|---|
| Verlag: | Aufbau-Verlag, Berlin 2025, 731 Seiten |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 12.11.2025 |
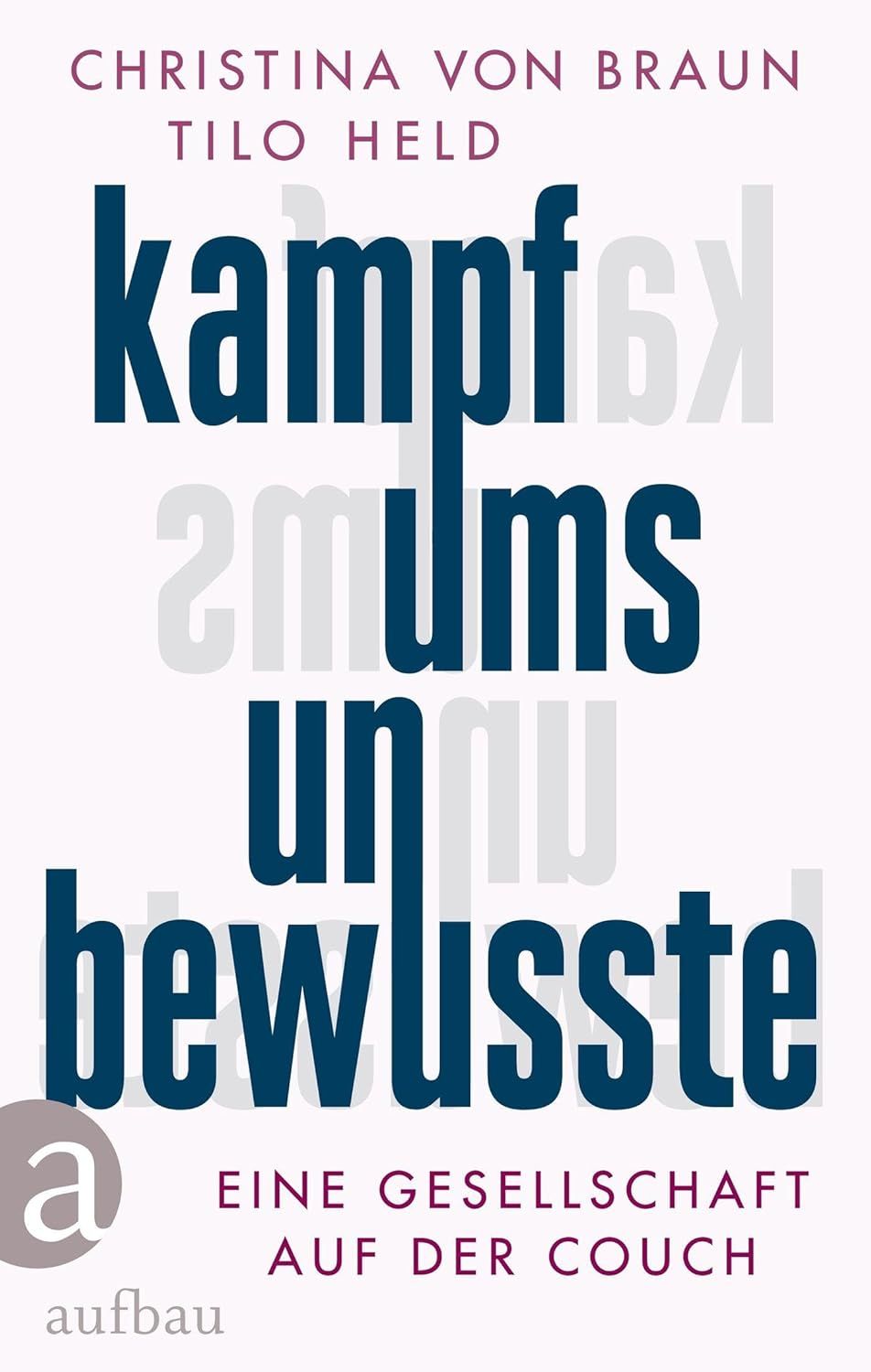
Christina von Braun und Tilo Held legen mit Kampf ums Unbewusste - Eine Gesellschaft auf der Couch (Aufbau Verlag, 2025) ein ebenso ambitioniertes wie problematisches Werk vor, das versucht, die Geschichte und Gegenwart des Unbewussten in kulturgeschichtlicher, psychoanalytischer und gesellschaftspolitischer Perspektive zu beleuchten. Das Buch ist, wie das Ehepaar selbst, eine Doppelgestalt: Der erste, umfangreichere Teil stammt von Christina von Braun, eine Kulturtheoretikerin und Filmemacherin, der zweite von Tilo Held. Held war ärztlicher Direktor einer großen Klinik in Bonn und ist Psychoanalytiker. Was beide verbindet, ist der dringende Wunsch, der Psychoanalyse in einer Zeit des schwindenden Einflusses und zunehmender Konkurrenz durch Neurowissenschaft, Verhaltenstherapie und digitale Psychotechniken neues Gewicht zu verleihen.
Von Braun entwirft eine faszinierende, zuweilen überbordende Genealogie des Unbewussten der vergangenen 200 Jahre. Sie verfolgt dessen Spuren von der Aufklärung über die Romantik, den Freudschen Diskurs und seine Abspaltungen bis in die digitalen Medien der Gegenwart. Eindrucksvoll geraten ihr die kulturgeschichtlichen Passagen über die „totalitäre Besetzung des Unbewussten“ – ein Kapitel, das die Instrumentalisierung psychischer Strukturen durch Nationalsozialismus und Stalinismus analysiert. Dass das Unbewusste zugleich zum Motor des Widerstands werden könne, ist eine schöne, wenn auch spekulative Idee, die weniger empirisch als moralisch überzeugt. Von Brauns Stärke liegt in der essayistischen Weite, weniger in systematischer Stringenz. Ihr Versuch, das Unbewusste als „letzte Bastion der Freiheit“ zu deuten, wirkt wenig überzeugend. Die Menschheit hat sich nur allzu oft als manipulierbar erwiesen.
Der zweite, kürzere Teil, geschrieben von Tilo Held, ist nüchterner. Er blickt auf die Entwicklung der Psychoanalyse in Deutschland, ihre Verdrängung durch die Verhaltenstherapie und auf ihre Versäumnisse bei der Analyse neuerer Entwicklungen. Die Bindungsforschung wurde lange Zeit heftig bekämpft, das neue Geschlechterverhältnis und die neuen Medien zunächst ignoriert. Auch die Bedeutung von Trauma- und Resilienzforschung habe die klassische Psychoanalyse bis heute nicht aufgegriffen.
Held plädiert für eine Öffnung der Psychoanalyse gegenüber den Nachbardisziplinen. Seine Kapitel über die Nachwirkungen des Nationalsozialismus und die Entschädigung von NS-Opfern zählen zu den stärksten des Buchs und berücksichtigen auch neue Forschungsergebnisse. In Verbindung mit der Resilienzforschung ergibt sich ein ganz neuer Blick auf diese Personengruppe. Dort, wo Held die soziale Einbettung des Individuums als entscheidend für psychische Gesundheit beschreibt, gelingt ihm eine seltene Verbindung von klinischer Erfahrung und gesellschaftlicher Reflexion. Doch auch auf diesem Gebiet hat die Psychoanalyse noch nicht Fuß gefasst.
Gemeinsam suchen beide Autoren nach einer Antwort auf die Frage, ob die Psychoanalyse als Erkenntnisinstrument gesellschaftlicher Selbstreflexion noch taugt. Ihr Fazit ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Wiederbelebung einer analytischen Haltung, die Misstrauen gegenüber autoritären Versuchungen und ideologischen Verführungen schulen soll. Sie fassen dies in die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Skepsis als Gegenmittel zu autoritären Ideologien. Doch gerade dort, wo das Buch an Klarheit gewinnen müsste – nämlich in der Bestimmung dessen, was das Unbewusste heute eigentlich ist und wer um es kämpft –, verliert es sich in metaphorischer Rede. Das Unbewusste wird zum politischen Subjekt, zum Gott-Ersatz, zur Projektionsfläche – und bleibt damit letztlich unbegreifbar.
Kampf ums Unbewusste ist in seiner Gelehrsamkeit beeindruckend, in seiner Begriffsschärfe aber schwankend. Es changiert zwischen Geschichtsbuch, kulturkritischem Essay und Verteidigungsschrift für eine bedrohte Disziplin. Von Braun schreibt mit großer intellektueller Energie, doch ihre These, dass die Psychoanalyse eine Antwort auf die Krise der Demokratie sei, bleibt mehr Wunsch als realistisches Programm. Auch Held kann nicht überzeugen, wenn er therapeutische und gesellschaftliche Dimensionen verbindet. Was sich aus den bisherigen Versäumnissen der (deutschen) Psychoanalyse für die Zukunft ableiten lässt, bleibt vage. Über die Ignoranz der klassischen Psychoanalyse gegenüber neueren gesellschaftlichen Entwicklungen ist schon viel geschrieben worden. Aus dieser Position der Schwäche heraus wird sich die Psychoanalyse nur schwerlich zu einem Instrument der Kulturanalyse aufschwingen können.
Auch nicht neu ist die Frage, ob sich ganze Gesellschaften oder zumindest größere Gruppen kollektiv analysieren lassen. Die Antwort steht fest: Es geht nicht. Die Instrumente zur Analyse der Psyche sind nicht per se aufklärerisch. Das zeigt der Missbrauch in totalitären Regimes. Auch hat die Psyche einige Schattenseiten, wie beispielsweise das Vergessen und das Verdrängen. Das gilt auch für die kollektive Psyche. Die Kritik- und Urteilsfähigkeit liegt innerhalb der Grenzen des Ich. Auf der individuellen Ebene bedarf das Ich der Triangulierung von Mutter, Vater und Kind in der frühen Kindheit. Welche Institutionen oder Prozesse wären das auf gesellschaftlicher Ebene? Die in der Psychoanalyse als Therapieform mögliche Tiefe der Selbsterkenntnis lässt sich nicht auf ganze Gesellschaften übertragen. In der jüngeren Vergangenheit ergab sich mindestens eine ernsthafte Gelegenheit zu einer kollektiven Selbstbesinnung, die einer Analyse einer gesellschaftlichen Psyche bislang am nächsten kam: die Entnazifizierung und Reeducation der westdeutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg. Held erwähnt sie, geht aber nicht weiter darauf ein.
Trotz der offenkundigen Versäumnisse der Psychoanalyse sind die beiden Autoren überzeugt, dass diese in einer erneuerten, zeitgemäßen Form als Instrument der „Therapie, Erkenntnis und Kulturkritik“ besonders in unserer krisengeschüttelten Zeit geeignet sein kann, psychische und intellektuelle Resilienz zu stärken. „Die Denkmuster der Psychoanalyse schulen die Skepsis“, heißt es in diesem Mammutwerk, sie kann jeden Einzelnen dazu befähigen, zwischen Bewusstem und Unbewusstem zu unterscheiden, also zu differenzieren und zu reflektieren, anstatt blind emotionalen Glaubenssätzen und Ideologien zu folgen.
Doch kann die Psychoanalyse diese Aufgabe erfüllen? Es mangelt bereits an einer handhabbaren Definition des Unbewussten. Es gilt als unberechenbar und gefährlich, wie auch als schöpferisch und produktiv. Sehr oft ist vom Unbewussten die Rede, obwohl eigentlich die Psychoanalyse gemeint ist. Andererseits zeigt sich „die Psyche“ auch immer wieder resilient gegen Vereinnahmungsversuche, selbst im Konzentrationslager. Aber ist geschlechtliche Diversifizierung ernsthaft ein Ausdruck von psychische Widerstandskraft? (S. 489) Der Kampf scheint nicht der um die Psyche zu sein, sondern der um Freiheit – auch die Freiheit des Individuums.
Es wird nicht deutlich, welche Lücke dieses Buch schließen soll und worauf genau es abzielt. Welcher Politiker würde heute noch einen Analytiker zurate ziehen? Im akademischen Bereich verschwindet die Psychoanalyse langsam aus den Lehrplänen und wird zunehmend von Verhaltenstherapie und Neurobiologie verdrängt, statt eine Synthese einzugehen. Neue Erkenntnisse widerlegen viele Behauptungen Freuds und der Neopsychoanalyse, etwa den Ödipus-Komplex oder das Inzesttabu. Neurobiologie kann deutlich machen, warum Psychotherapie und überhaupt psychische Veränderung so schwer und oftmals erfolglos ist. Das bedeutet auch, dass psychoanalytisches Wissen in seinem Unterstützungspotenzial für politische Resilienz deutlich begrenzt ist.
Das Fazit fällt gemischt aus: Für Kenner der Psychoanalyse bietet das Buch kaum neue Informationen, für den interessierten Laien immerhin eine Fülle an Denkanstößen, historischen Rückblicken und aktuellen Bezügen. Das Buch zeichnet ein eindrucksvolles Panorama über die Wandlungen des Unbewussten, die Instrumentalisierung des Unbewussten in totalitären Staaten, die Geschichte der psychoanalytischen Bewegung und ihre blinden Flecken. Doch es fehlen überzeugende Argumente, wie eine von anderen Disziplinen bereicherte Psychoanalyse zur Überwindung gegenwärtiger Krisen beitragen könnte.