
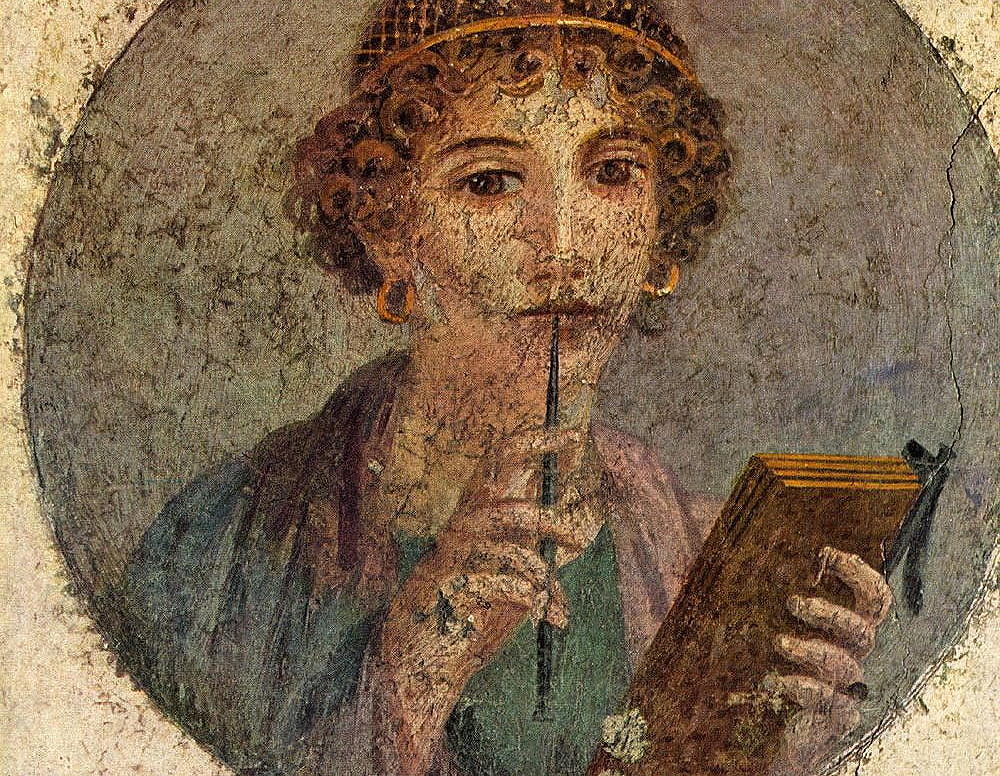

Klasse: Die Entstehung von Oben und Unten
| Autor*in: | Hanno Sauer |
|---|---|
| Verlag: | Piper, München 2025, 368 Seiten |
| Rezensent*in: | Gerald Mackenthun |
| Datum: | 06.10.2025 |
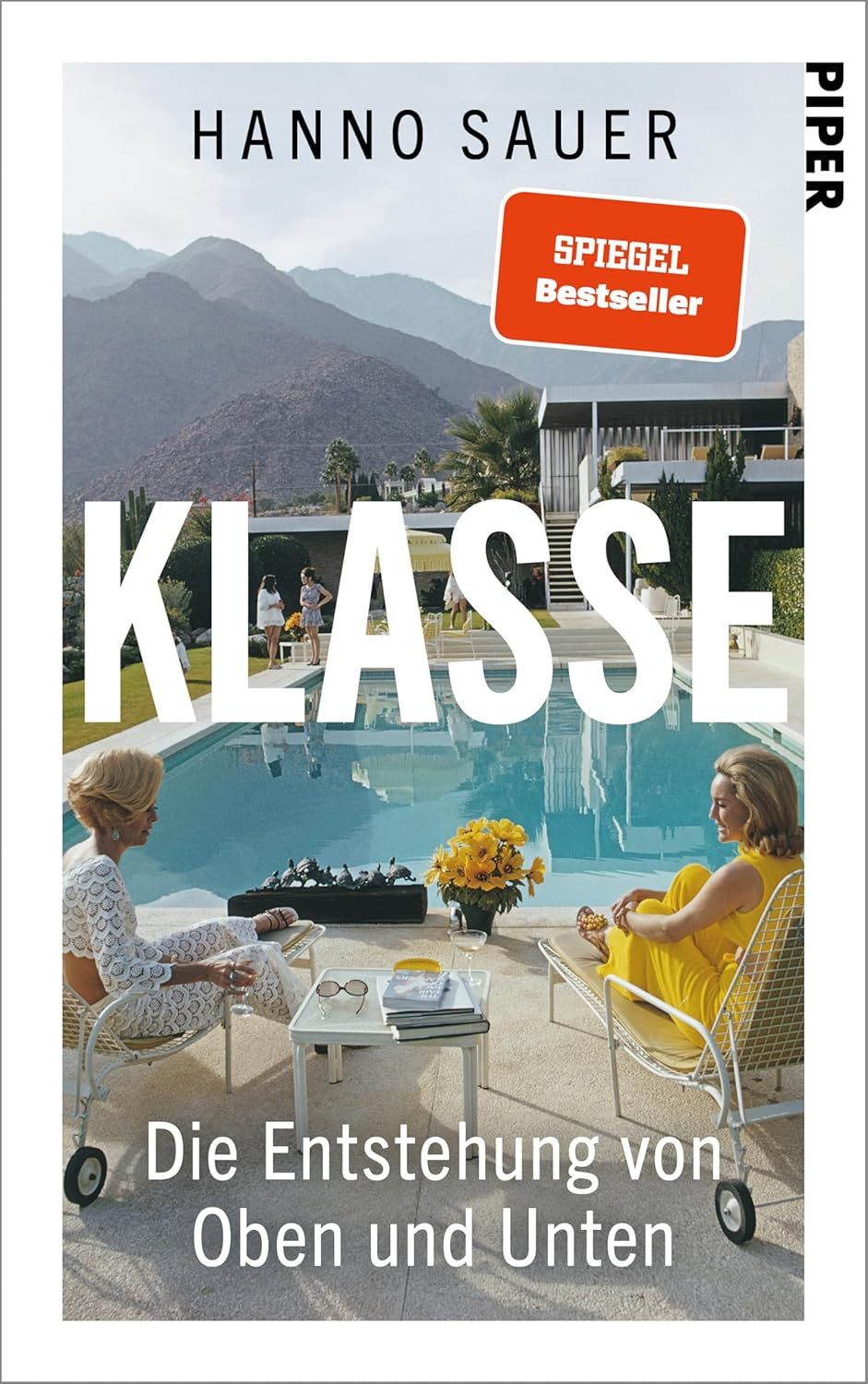
Ungleichheit wird vielfach beklagt, doch es scheint kein akzeptables Mittel zu geben, um gesellschaftliche Unterschiede ein für alle Mal zu beseitigen. Sowohl primitive als auch kommunistische Gesellschaften kommen dem Ideal der sozialen Gleichheit scheinbar am nächsten. Sie sind jedoch von Armut und Unfreiheit gekennzeichnet. Ihre Gleichförmigkeit ist nur scheinbar. Auch in ihnen gibt es ein Oben und Unten, gibt es Status und Hierarchien. Sind diese unvermeidlich? Mit dieser grundlegenden Frage setzt sich der 1983 geborene Philosoph Hanno Sauer in seinem Buch Klasse: Die Entstehung von Oben und Unten auseinander. Was sind Klassen, warum bestehen sie, wie funktionieren sie und warum sind sie so schwer loszuwerden?
„Klasse ist sozial konstruierte Knappheit“, heißt es gleich zu Beginn. Durch diese Knappheit entsteht ein Oben und Unten. Die Position der Individuen auf dieser vertikalen Skala ist durch Prestige, Macht und Besitz definiert. Sauer bezieht sich auf die großen Klassentheoretiker wie Karl Marx, Thorstein Veblen und Pierre Bourdieu, überformt und verändert deren Ansätze jedoch mit einer beeindruckenden Fülle neuerer Überlegungen und Forschungsergebnisse bis zur Unkenntlichkeit. Er spürt den offenen wie den geheimen Signalen gesellschaftlicher Unterschiede nach. Diese Signale werden geformt von Werten, Kultur, Sprache und Politik und wirken auf diese zurück. Die einfache Dichotomie von Arbeiterklasse und Kapitalisten, von oben und unten, von Angestellten und Selbstständigen löst sich in eine Fülle von Milieus mit ihren je eigenen Regeln und Statussymbolen auf. In seinem Buch erklärt Sauer den aktuellen Wandel moderner Statushierarchien. Dieses Verständnis werde helfen, die Gesellschaft zu verbessern.
Die sieben Kapitel des Buches beschäftigen sich mit den „sozialen Signalen“ von Gesellschaften, den ästhetischen Präferenzen von Klassen, dem moralischen Gewissen sozialer Eliten, der ökonomischen Seite sozialer Statushierarchien, der Gerechtigkeitsfrage („Inwieweit stellen Ungleichheiten Ungerechtigkeiten dar?“) und der Frage, ob eine klassenlose Gesellschaft möglich ist. Das Schlusskapitel skizziert einige Vorschläge, wie heutige Gesellschaften mit sozialen Ungleichheiten umgehen sollten.
Das Buch konnte zum Bestseller werden, da das Beklagen von angeblich ungerechter Ungleichheit in den vergangenen Jahrzehnten zu einem gesellschaftlichen Dauerthema in westlichen Gesellschaften wurde. An der Haltung zu Rassismus und Sexismus unterscheiden sich progressive und konservative Milieus voneinander. Es ist unbestritten, dass Respekt, Prestige, Einkommen, Besitz oder Anerkennung ungleich verteilt sind. Doch ist der Versuch, diese Ungleichheit zu nivellieren, nicht zum Scheitern verurteilt? Im Sozialstaat wird eine Angleichung durch Geldumverteilung von oben nach unten versucht, ohne dass eine Beruhigung oder Befriedung eintritt. Im Gegenteil: Je geringer die Unterschiede, desto größer die Empörung. Zudem kann Geld die feinen sozialen Signale nicht neutralisieren, mit denen sich die Bewohner der jeweiligen sozialen Milieus verständigen. Habitus, Kleidungsstil und Akzent sind ihre Merkmale. Die ethnische Zugehörigkeit ist nur ein Teilaspekt.
Sauer bemerkt, dass „Klassismus” von den meisten Menschen – mit Ausnahme offenkundiger oder eingebildeter Diskriminierung – nicht bemerkt und als legitim angesehen wird. Man kann nur sehr wenig gegen die Existenz von Statushierarchien tun. Ist eine Gesellschaft ohne Vorurteile und mit gleichen Chancen für alle realistisch? Die Kosten eines solchen Eingriffs in die Rechte und Werte vieler Menschen wären für eine große Mehrheit zu hoch, da er nur unter der Bedingung einer lenkenden Diktatur zu realisieren wäre. Von einer geschwisterlich-solidarischen Gesellschaft träumen viele. Zugleich ist der Individualismus in den westlichen Gesellschaften fest verankert. Beides passt nicht zusammen, man kann nicht alles zugleich haben. Sauer schreibt: „Das Problem sozialer Klassenunterschiede wird uns erhalten bleiben.“ Es gebe kein wirklich gutes und akzeptiertes Programm dagegen. Seitdem Menschen gelernt haben, Wohlstand zu schaffen, wird dieser ungleich verteilt. Der Traum von der klassenlosen Gesellschaft der Gleichen bleibt ein Traum.
Neben dieser Hauptthese verarbeitet Sauer viele weitere Erkenntnisse. Der demonstrative Konsum über das Lebensnotwendige hinaus ist ein starkes Signal der Superiorität. Luxuskonsum und Verschwendung sind ökonomisch unsinnig, zeigen aber genau die soziale Höhe an, die eine Person erreicht hat. Da kaum jemand auf diese „teuren Signale” verzichten will, steigen Konsum, Produktion und Ressourcenverbrauch – mit den bekannten Folgen der Zerstörung der Erde. Letztlich spiegelt sich diese Haltung im steigenden CO2-Ausstoß wider. Ein nicht minder dazu beitragender Faktor ist die unübertroffene Kooperationsfähigkeit der Spezies Mensch. Diese funktioniert nur mit Vertrauen, und genau das signalisieren die sozialen Distinktionsmerkmale: „Ich bin in etwa wie du, du kannst mir vertrauen.“ Umgekehrt markiert das Fehlen dieser Attribute den Außenseiter.
Linke und progressive Gruppen und Bewegungen versuchen dennoch unverdrossen, durch Umverteilung von Geld die gröbsten Auswüchse der Statuskämpfe zu mildern und Angehörigen niederer sozialer Schichten vor allem durch Bildung den Aufstieg zu erleichtern. Schuluniformen beispielsweise können die materiellen Unterschiede der Eltern kaschieren. Dadurch werden unweigerlich andere Merkmale aufgewertet: Größe und Kraft, solidarisches Verhalten oder die Schulnoten. Gleichheit gibt es immerhin in den Menschenrechten und vor dem Gesetz. Prestige, Statur und Distinktion lassen sich auch mit offenkundig Widersinnigem gewinnen. Außenstehende mögen diese Signale als irrational oder selbstschädigend empfinden, die In-Group wird sie verstehen.
Indem Sauer Status als „die begehrteste Ressource der modernen Welt“ begreift, verlagert er die Aufmerksamkeit von klassischer Umverteilung zu subtileren Machtmechanismen, die oft im Hintergrund wirken. Der Titel seines gut lesbaren Buches hätte jedoch besser „Status“ gelautet. Der Autor arbeitet reichlich mit Beispielen und Beobachtungen, weniger mit systematisch erhobenen Daten. Das liegt sicherlich an der Subtilität und der oftmals fehlenden Offensichtlichkeit des Gegenstands. Einige Rezensenten kritisieren, dass Sauer keine Schlussfolgerungen oder politischen Strategien liefert. Durch die Dominanz des Themas „Status“ bleiben bei Sauer die ökonomischen und institutionellen Machtasymmetrien eher im Hintergrund.
Mit Klasse ist Sauer ein tief reflektiertes, anspruchsvolles und dennoch kurzweilig zu lesendes Buch gelungen, das in einer Zeit, in der Ungleichheiten oft rein wirtschaftlich diskutiert werden, einen vielschichtigeren Blick anbietet. Eliten definieren sich durch Bildung, Machtstrukturen, kulturelle Deutungshoheit und die Fähigkeit zur Normsetzung. Diese Eigenschaften vereint die progressistische Linke seit den 1970er Jahren auf sich. Deren Hegemonie wurde offenbar überstrapaziert und wird in jüngerer Zeit durch eine restaurative Rechte zunehmend infrage gestellt.
Indem Sauer die Unvermeidlichkeit von Hierarchien belegt, vermeidet er eine Verengung des Themas auf eine moralische Schuldzuweisung. Sein Anliegen, die Leser für subtile Mechanismen von Elitebildung und Status zu sensibilisieren, ist gelungen. Das Werk ist jedoch kein programmatisches Handbuch, und der Autor bietet keine Lösungen an. Leser, die konkrete Schritte zur Transformation erwarten, werden unbefriedigt bleiben. Dennoch ist Klasse ein fundamentaler Beitrag zur Debatte über soziale Ungleichheit.