
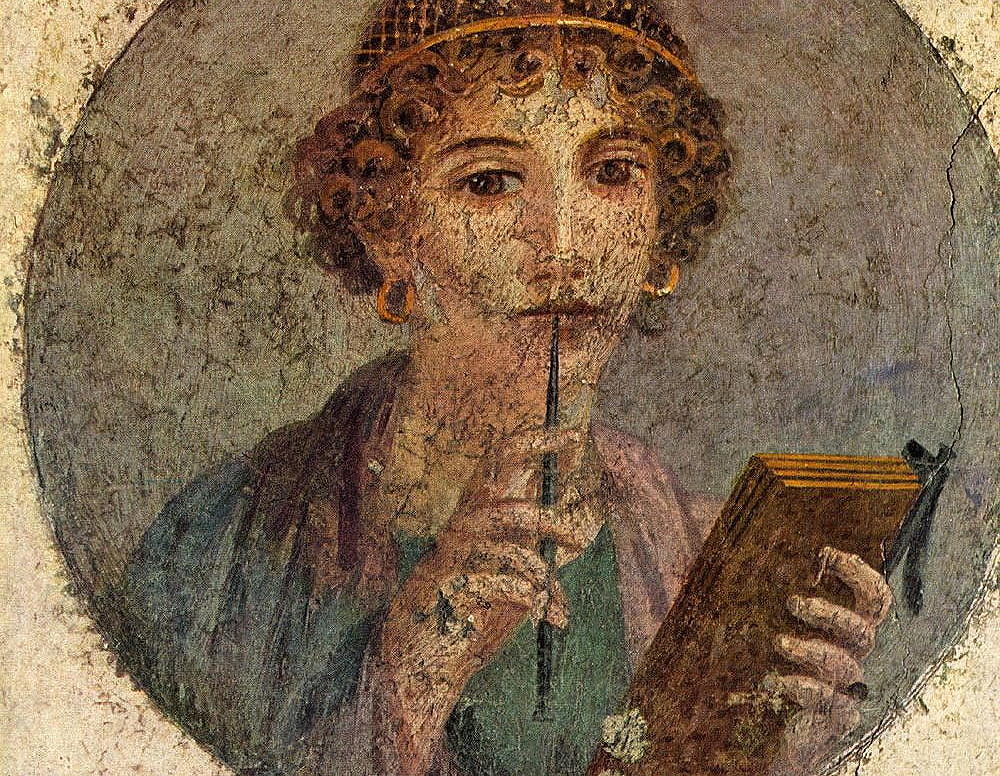

Ethik der Verletzlichkeit
| Autor*in: | Giovanni Maio |
|---|---|
| Verlag: | Herder, Freiburg im Breisgau 2024, 160 Seiten |
| Rezensent*in: | Annette Schönherr |
| Datum: | 18.06.2025 |

Giovanni Maio, geboren 1964 in Italien, ist Arzt und Philosoph und lehrt als Professor für Bioethik und Medizin-Ethik an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg. In seinen Werken kritisiert er das mechanistische Menschenbild in der Medizin und setzt sich mit den ethischen Grenzen der Ökonomisierung und Technisierung der Medizin auseinander. Sein Plädoyer gilt einer wissenschaftlichen und zwischenmenschlichen Medizin. Das im Herbst 2024 erschienene Buch über die Grundlagen einer Ethik der Verletzlichkeit ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstanden und reicht über den medizinischen Rahmen ins Gesellschaftliche hinaus. Entgegen aller Autonomiebestrebungen verweist es auf die Grundbefindlichkeit menschlicher Verletzlichkeit und Angewiesenheit, die der Autor auch verstanden wissen will als Ressource, unsere Sensibilität und Solidarität für die existenziellen Nöte der Mitmenschen zu stärken.
Ausgehend von dieser Prämisse ruft der Autor dazu auf, den Menschen von seiner Grundverletzlichkeit her neu zu denken. Die Medizin ist in besonderer Weise mit der Verletzlichkeit des Menschen konfrontiert, die ihn im Krankwerden existenziell angreifbar macht. Daher richtet sich das Buch insbesondere an Vertreter der Heilberufe und vertieft u.a. die Fragen, wie die Verletzlichkeit des Menschen anthropologisch zu begreifen ist, worin sie besteht, was die Verletzlichkeit speziell im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen bedeutet, und wie eine ethische Antwort auf diese Fragen gegeben werden könnte.
Die Verletzlichkeit ist als Grundkonstante untrennbar mit der Verfasstheit des Menschen verbunden, da sich menschliches Leben in der Interdependenz mit anderen vollzieht: Ohne Verletzlichkeit gäbe es keine Berührbarkeit, kein Vertrauen, keine Bindung und Entfaltung. Insofern ist Verletzlichkeit auch Ressource und als solche ein Entwicklungs- und Transformationspotenzial. Im Zusammenhang mit dem Verwiesensein des Menschen auf andere ist die Verletzlichkeit eine soziale Tatsache und wird als Grundbedingung für die Ausbildung von Selbstvertrauen behandelt, des Weiteren als Unverfügbarkeit, die sich zu einem beträchtlichem Teil dem eigenen Einfluss entzieht und den Menschen in seinem Angewiesensein besonders verletzlich macht sowie des Bewusstseins der eigenen Sterblichkeit, die den Menschen mit der Unausweichlichkeit und Unwiederbringlichkeit der eigenen verstreichenden Lebenszeit konfrontiert.
Über die anthropologischen Grundüberlegungen hinaus, wendet sich der Autor dem Eigentlichen der Verletzlichkeit zu als einem Zustand der Schwebe i.S. eines „Nicht-mehr und Noch-nicht“. Als weiterer Aspekt der Verletzlichkeit im Kranksein wird die Thematik der Scham erörtert: Sie prädestiniert zu Körperscham, Identitätsscham und Sozialscham. Kranksein tastet die innere Integrität des Kranken an, einen Bruch des Selbstbildes zu erleiden. Hinzu kommt u.a. das oft krankheitsbedingte Angewiesensein auf äußere Hilfe, die das Selbstbild weiter erschüttern kann.
Für die Medizin ist die Reflexion auf die Verletzlichkeit von besonderer Relevanz, denn gerade in Situationen erhöhter Verletzlichkeit ist der Kranke mit der Medizin konfrontiert. Daher ist es entscheidend, „was die Medizin tut und wie sie es tut.“ Angesichts der erhöhten Verletzlichkeit ist es umso dringlicher, eine Haltung adäquater Sorge Kranken gegenüber zu entwickeln, als Kranksein mit der Gefahr einhergeht, das Zutrauen zu sich selbst zu verlieren, das durch Zutrauen der Sorgenden wiederum gewonnen werden könnte, um in neuer Weise Autonomie zu erlangen. Die Ethik der Sorge wird eingehend behandelt - was „Sorge“ überhaupt ist und welche Handlungen eine Sorgehaltung beinhalten muss, um sie von einer bloßen Verrichtung zu unterscheiden.
Es ist das Anliegen des Autors, den Begriff der Verletzlichkeit als eine Grundtatsache in neuer Weise in die Medizin einzuführen und die Verletzlichkeit als integralen Wesenszug des Menschen zu verstehen. Die Vergegenwärtigung der Verletzlichkeit verändert den Zugang zur Welt des Kranken: Sie ist integraler Bestandteil einer Ethik der Verletzlichkeit, um aufmerksam zu werden für all jene Strukturen und Formen des Umgangs, die vulnerabilisierend auf den Menschen einwirken. Insbesondere geht es um eine Sensibilisierung für die jeweils unverwechselbare Situation des kranken Menschen, um mit Umsicht, Behutsamkeit und Achtung vor dem Sosein des anderen seine ihm verbliebenen Potenziale ausfindig zu machen und zu fördern, damit seine Verletzlichkeit durch adäquate Sorge in ein Potenzial der Entwicklung verwandelt werden kann.