
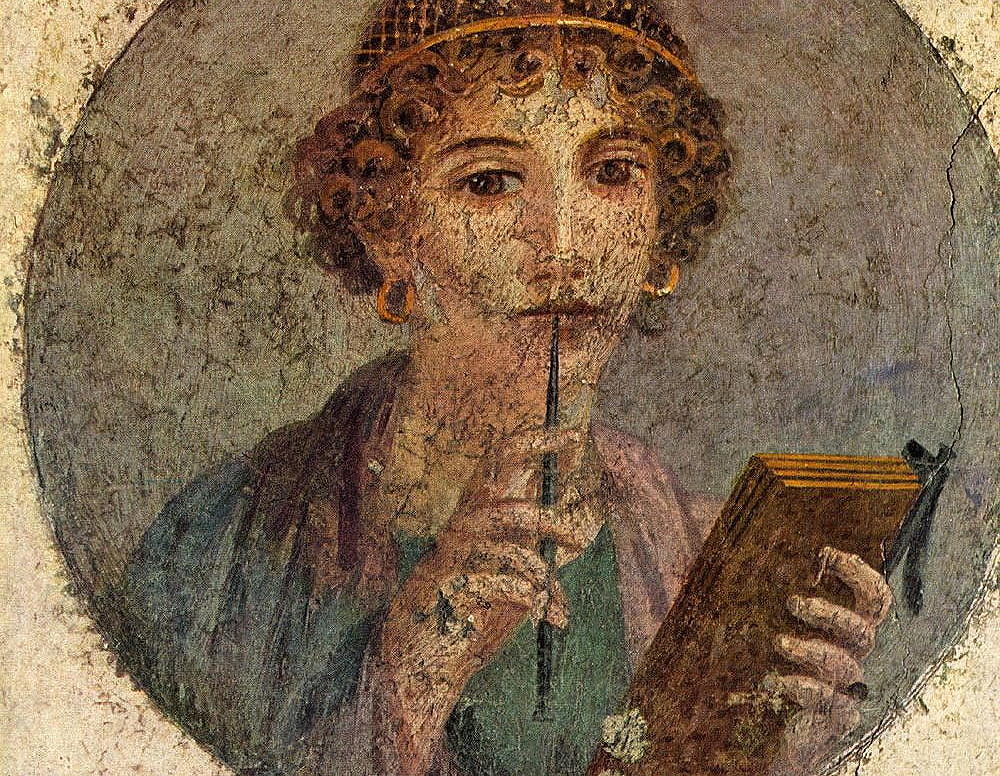

Eine kurze Geschichte der Menschheit
| Autor*in: | Yuval Noah Harari |
|---|---|
| Verlag: | Pantheon, München 2014, 528 Seiten |
| Rezensent*in: | Matthias Voigt |
| Datum: | 07.08.2025 |
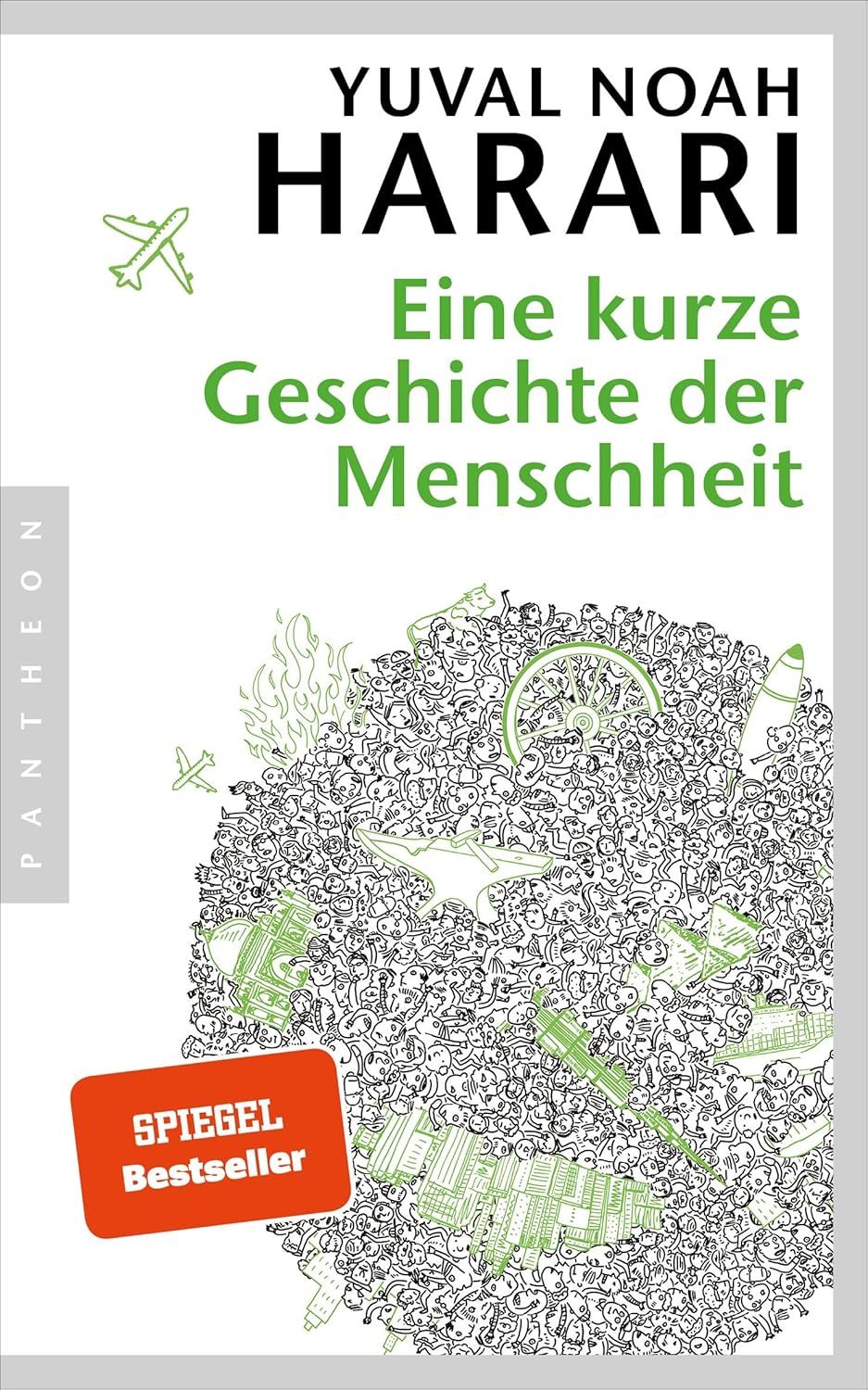
Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, so überschrieb Immanuel Kant im Jahre 1784 seinen Entwurf zu einer Geschichtsschreibung im Geiste der Aufklärung. Sie endet mit dem schönen Traum von einer Weltregierung, die Kriege künftig unmöglich machen sollte. 230 Jahre später zeichnet der israelische Historiker Yuval Noah Harari in seiner Kurzen Geschichte der Menschheit das Bild einer bedrohten Zivilisation, geprägt von den negativen Folgen des menschlichen Fortschritts. Er konfrontiert uns mit belastendem Material, indem er den derzeitigen Stand einer entfesselten Moderne präsentiert.
Vor uns Lesern wird in nüchterner Sachlichkeit eine schier unglaubliche Menge an Fakten aus nahezu allen Bereichen der Wissenschaften ausgebreitet. Die Erfolgsstory des Homo sapiens beginnt mit der Ausrottung aller konkurrierenden Früh-Menschenarten (z.B. Neandertaler). Diese fielen einer „kognitiven Revolution“ zum Opfer, die durch den Homo sapiens in die Welt gebracht wurde.
Was Harari als entscheidenden Wendepunkt der menschlichen Geistesentwicklung beschreibt, hat etwas von einem Gegenstück zur Erzählung der Aufklärung. Das 18. Jahrhundert glaubte an eine Vernunft, die sich gegen alle Konkurrenten und Feinde, vornehmlich gegen Mythen, Aberglauben und Religionen, den Weg der Selbstfindung des Menschengeschlechts bahnt. Bei Harari erscheint die globalisierte Menschheit nicht als Opfer böser Mächte oder demagogischer Verführer, sondern als das Ergebnis einer unheilvollen Kooperation. In seiner Analyse herrscht zwischen Wissenschaft, Kapital und Militär eine Arbeitsteilung, der sich niemand entziehen kann.
Seine Darstellung der Menschheitsgeschichte führt uns all die Kollateralschäden vor Augen, die den Siegeszug des geistgerüsteten Menschen begleiten: Als sesshafter Ackerbauer besetzte Homo sapiens den ursprünglichen Lebensraum der Neandertaler und aller anderen jagenden und sammelnden Erdenbewohner. Mit Hilfe seiner überlegenen Intelligenz entwickelte er eine Symbolsprache, mit deren Hilfe er in jeder Hinsicht Geschichte machen konnte.
Der Zentralgedanke hierbei: Mit der Symbolsprache war ein Instrument geschaffen, das Dinge und Sachverhalte zu sehen lehrt, die es in der Realität nicht gibt (Abstraktion). Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich etwas vorzustellen, das erst künftig sein soll und dann erst real wird. Was wir derart imaginieren, existiert als Ein-Bildung, um dann aus ihrer symbolischen Einkleidung aus-gewickelt zu werden. Mithilfe dieser revolutionären Befähigung ließ sich die Zeit zurückdrehen oder auch virtuell um beliebige Einheiten vorstellen. Diese Phantasie-Tätigkeit erlaubte es dem Menschen, sich über das räumlich Gegebene hinwegzusetzen und Zukunftsszenarien zu entwickeln; und diese Fähigkeit zur Fiktion und Imagination wurde zentral für die menschliche Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft.
Das hatte für das Lebensgefühl einschneidende Folgen. Statt zu genießen, was der Tag an Essbarem bot, übte Homo sapiens nicht selten Verzicht. Seine vorauseilende Findigkeit verhieß ihm größere Befriedigung, wenn man für eine Zukunft Vorräte sammelte. Als Belohnung winkte dafür ein Vielfaches bei der kommenden Ernte; Sigmund Freud fasste diesen Vorgang später im Begriff der Sublimierung. Von diesem sublimierungsfähigen Menschen spricht die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament allerdings weniger positiv. Dort wird derselbe Vorgang als Sündenfall von Adam und Eva gewertet. Vertrieben aus dem Paradies, sollten deren Nachfahren fortan im Schweiße des Angesichts ihr Dasein fristen.
Anders als Kant oder Hegel sucht Harari nicht nach einem Sinn, dem das Menschheitsprojekt möglicherweise folgt. Sein Interesse gilt den Kraftfeldern, die im Prozess der menschlichen Zivilisation die Geschichte in Fahrt halten. Für den Leser fällt hierbei nicht nur einiges an Wissenszuwachs ab; ich jedenfalls habe immer wieder über die Unbefangenheit gestaunt, mit der Harari scheinbar Unzusammenhängendes aufeinander bezieht, so dass sich neue Zusammenhänge auftun.
In einem der ersten Kapitel – Die Peugeot-Legende überschrieben – exemplifiziert er seine These über die Rolle der Phantasie im Lebensalltag des Homo sapiens. Was er am Beispiel des französischen Automobilproduzenten wie nebenbei entwickelt, ist gewissermaßen Hararis Beitrag zur Kapitalismus-Theorie. Demnach lässt sich der weltweite Erfolg der kapitalistischen Warenproduktion nur dann verstehen, wenn wir die konstitutive Rolle des Glaubens für die im Wirtschaftsprozess Beteiligten erkennen. Ohne den Glauben, dass ein Kreditgeber seinen eingebrachten Anteil auch wieder zurückerhalten werde, gäbe es keinen Kapitalismus. Dieser Glaube ermöglicht es uns zugleich, mit selbstgewählten Abhängigkeiten, wie sie z.B. mit der Kreditaufnahme eingegangen werden, zu leben. Wer nun skeptisch fragen mag, warum man denn hier Selbstverständlichkeiten zum Glaubensphänomen erhebt, der erliegt vermutlich einem semantischen Vorurteil. Er übersieht die lebensweltliche Bedeutung des Verbes glauben. Glaubensgewissheiten resultieren nicht aus rationalen Schlussfolgerungen, sondern aus emotionalen Empfindungen.
Evolutionär betrachtet ist Homo sapiens eine Gattung, die etwas vollbringt, was keine andere kann: Sie erschafft ständig Dinge und Verhältnisse, die von der Natur so nicht vorgesehen waren. Dieser Erfindungsgeist kann in der Welt wirksam werden, weil er in der wechselseitigen Verbundenheit der ihn tragenden "Gläubigen" lebt. Insofern ließe sich unsere Spezies auch als die des Homo religiosus bezeichnen.
Sieht man in Glaubensphänomen Spielarten der Seinsgewissheit, ändert das den Blick auf die vielen Erscheinungsformen des Glaubens in unseren Tagen. Sie kommen uns dann nicht bloß als dem Zeitgeist geschuldete Ersatzphänomene vor. Was uns die Konsum-Welt in schönen Bildern verheißt, setzt an unserer Sehnsucht nach Teilhabe am richtigen Leben an. Die Dynamik aus Begehren und Enttäuschung, sobald das Ersehnte erworben ist, wird zum Perpetuum mobile im Seelenleben des modernen Menschen. Auf der Strecke bleibt, was Halt geben könnte: die Gemeinschaft von Mitmenschen.
Hariris kurze Geschichte beschreibt einen Entwicklungsweg, der immer tiefer in eine unwirtliche Welt führt. Sein Buch endet mit dem Albtraum, in der die Künstliche Intelligenz uns zu ihren willigen Helfern gemacht hat. Vor 200 Jahren waren für empfindsame Geister mit den ersten Fabrikschloten die Anzeichen einer neuen Zeit spürbar. Einer von ihnen, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, wollte damals noch glauben, dass die „List der Vernunft“ letztlich mit uns ein gutes Spiel treibe. Letzten Endes lasse uns der Weltgeist die von ihm vorgegebenen Zwecke verfolgen, ohne dass uns dies bewusst werde. Wo wir aus eigenen Interessen zu handeln meinen, tragen wir nach Hegel zur Verwirklichung der Weltvernunft bei.
In Hararis Beschreibung der Geschichte mutiert der Hegelsche Weltgeist zum Betriebssystem, das uns ständig zum Update aufruft, immer aufs neue insistierend, dass wir uns aus freier Entscheidung in den Dienst Künstlicher Intelligenzen stellen lassen. Eine ungebremste techische Entwicklung lasse uns die Kontrolle über die eigene Zivilisation verlieren. Zwar nimmt sie uns die Last der Verantwortung, aber damit auch die letzten Reste von dem, was frühere Generationen als die Würde des Menschen erachteten.