
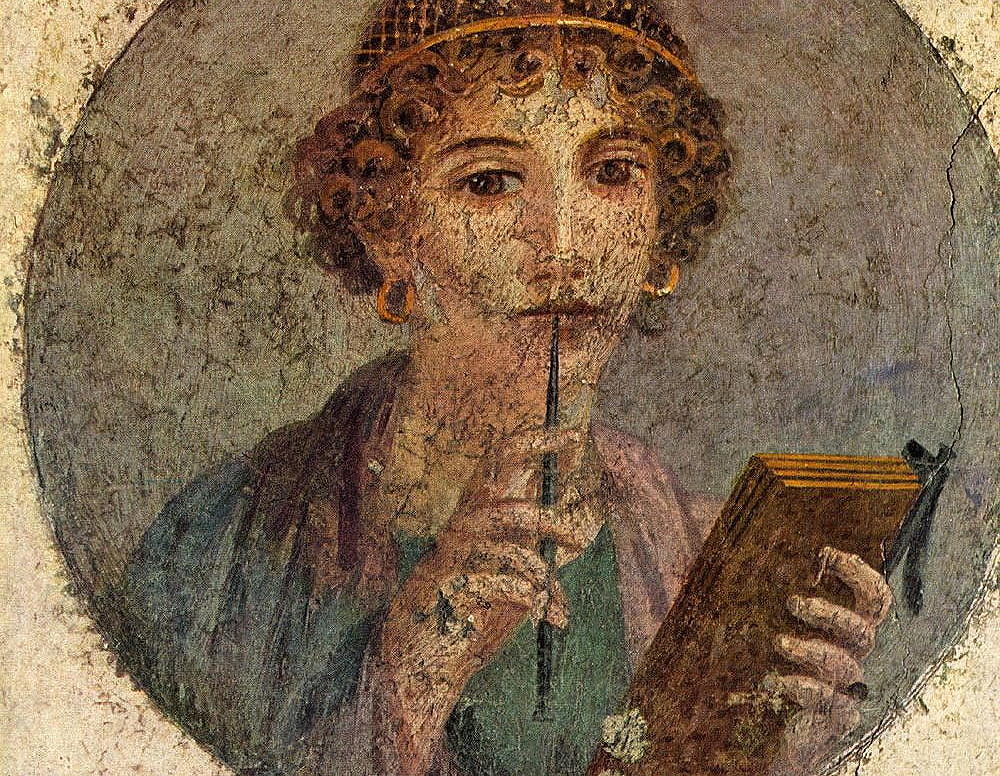

What We Can Know / Was wir wissen können
| Autor*in: | Ian McEwan |
|---|---|
| Verlag: | Jonathan Cape, London, 2025, 301 pp. / Diogenes |
| Rezensent*in: | John Burns |
| Datum: | 20.10.2025 |
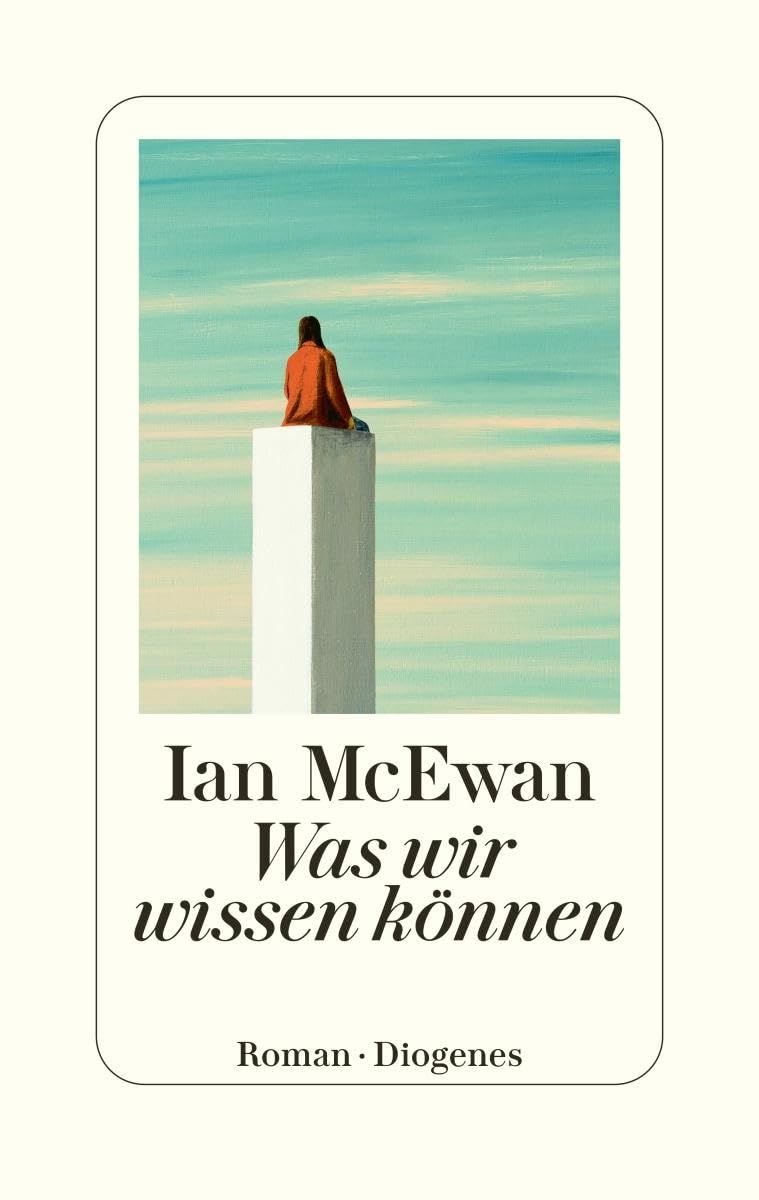
Im neuesten Roman des renommierten englischen Schriftstellers Ian McEwan leben die Menschen im Jahre 2119 auf kleinen Inseln der Zivilisation. Nach mehreren regionalen Atomkriegen und am Ende einer Klimakatastrophe, die heftige Stürme, Seebeben und Tsunami ausgelöst hat, befinden sich die akademischen Archive, welche die kulturellen Leistungen vergangener Generationen dokumentieren, auf Anhöhen und Bergen. Einige Universitäten haben sich über die Jahre der Umweltzerstörung hinweggerettet, so dass es noch möglich ist, die Kulturgeschichte einer vorsintflutlichen Epoche zu erforschen.
In den Vorlesungen und Seminaren der geisteswissenschaftlichen Fakultät der University of the South Downs versuchen der Erzähler Tom und seine Kollegin Rose, die apathischen Studenten und Studentinnen für ihre Spezialfächer zu interessieren. Wie sah es z.B. im Jahre 2014 in Großbritannien aus? Was war das Charakteristische an der damaligen Kultur?
Die Menschen in der Zeit vor der großen Katastrophe zeichneten sich durch einen Hang zur Selbstzerstörung aus; sie waren durchaus bereit, die Zukunft künftiger Generationen zu gefährden. Dennoch hat die Kultur Kunst und Dichtung von hohem Niveau hervorgebracht.
Neben der Vergnügungssucht einer Generation, die Musikfeste, Urlaubsreisen, kulinarische Spezialitäten und Fußball über alles liebte, gab es doch einige Denker, die durch die militärische Aufrüstung und die Überschätzung der Bedeutung von neuen Technologien sehr beunruhigt waren.
Die Studenten und Studentinnen, die Tom und Rose unterrichten, interessieren sich wenig für die Vergangenheit. Kevin Howard, ein beredter Graduierter, äußert in einer Seminarsitzung seinen Unmut über Inhalte, die ihn und seine Kommilitoninnen gar nicht interessieren. „Wir wollen nicht in Nostalgie schwelgen“, meint der selbsternannte Volkstribun. „Wir wollen im Hier und Jetzt leben.“ Die jungen Menschen stimmen ihrem Sprecher zu und verlassen den Raum.
Tom, der „mit einem, oder vielleicht sogar mit zwei Füßen in der Vergangenheit lebt“, nutzt die Semesterferien, um ein philologisches Rätsel zu lösen. Unter beschwerlichen Bedingungen begibt er sich auf die Suche nach einem verlorenen Gedicht, das der berühmte Dichter Francis Blundy im Jahre 2014 bei einem Abendessen seinen Freunden vorgetragen hat. Obwohl das Leben des Dichters anhand der digitalen Technik genau erforscht und der Abend im Tagebuch von Vivien, der Frau des Poeten, detailliert beschrieben wurde, fehlt jegliche Spur des Meisterwerks.
Die erste Hälfte des Romans befasst sich unterschwellig mit der Frage des Gedächtnisses und der menschlichen Perspektive auf Zeit und Historizität. Was haben wir davon, wenn wir in die Rolle eines Menschen hineinschlüpfen, der Jahrhunderte vor uns gelebt hat? Was empfinden wir, wenn wir eine wichtige Entscheidung treffen, die wir später bereuen? Haben wir überhaupt zuverlässige Erinnerungen an unsere Vergangenheit? Möglicherweise löst sich die Persönlichkeit eines Menschen durch Alterskrankheiten auf, wie im Fall von Percy, dem Ehemann Viviens.
McEwan ist mit einer meisterhaften Fähigkeit ausgestattet, komplexe Themen anschaulich darzustellen, Spannung zu erzeugen und mehrere Erzählstränge gleichzeitig zu entwickeln. Im zweiten Teil des Romans löst sich das Rätsel des verschollenen Gedichts im inneren Monolog der Frau des Dichters auf. Der Roman wird zum Thriller, vielleicht auch zum Melodram, dessen Ende jeder für sich entdecken soll. Die Leser werden bis zur letzten Seite des Romans in Atem gehalten.
Bisweilen scheint aber der Autor die Geduld seiner Leser und Leserinnen stark auf die Probe zu stellen. Warum soll ich mich für die disparate Runde von Intellektuellen mit ihren zerstrittenen Ehen, ehrgeizigen Berufszielen und Familientragödien interessieren, fragte ich mich manchmal beim Lesen. Obwohl ich die Belesenheit, das Wissen und die stilistische Meisterleistung McEwans bewundern konnte, hat es mich irritiert, dass seine Charakterdarstellungen oft sehr schematisch bleiben. Seine Protagonisten und Protagonistinnen reden viel und grübeln noch mehr über die Tücken des täglichen Lebens. Wenn sie zielstrebig handeln, verstricken sie sich in den kniffeligen Situationen, in die sie hineingeraten sind, statt adäquate Lösungen dafür zu finden.
Es werden kaum Persönlichkeiten geschildert, die relativ schuldfrei ein glückliches Leben führen. Vielleicht versteht sich McEwan, der unter anderem französische Literatur studierte, als englischen Moralisten. Von größter Bedeutung im Leben und Schaffen des englischen Romanciers sind aber nicht die Franzosen La Rochefoucauld, Stendhal oder Balzac, sondern englische Autoren, wie Charles Darwin, Aldous Huxley und George Orwell.
Das Dilemma des modernen Autors, wie McEwan in seiner Interpretation der Literaturästhetik George Orwells erläutert, besteht in der Notwendigkeit, die kreative Fantasie walten zu lassen, während das Bewusstsein draußen in der sozialen Welt mit den antihumanen Strebungen in Politik und Wirtschaft beschäftigt ist. Soll der Schriftsteller wie Henry Miller im „Innern des Wals“ leben und sich um politische Ereignisse gar nicht kümmern, oder soll er den Bauch des Wals verlassen wie Orwell im spanischen Bürgerkrieg?
Heutzutage ist der Wal im seichten Gewässer gestrandet und nur noch ein Skelett, das dem Autor keine Geborgenheit schenken kann, schreibt McEwan. Der Schriftsteller hat Mühe, sich dem Trubel der Welt zu entziehen, um sich auf seine Kunst zu konzentrieren. McEwan zitiert hierzu den japanischen Haiku-Dichter Matsuo Basho (1644-1694):
Der alte Teich;
Ein Frosch springt hinein –
Der Klang des Wassers.
Internetquelle:
McEwan, Ian: Politics and the Imagination. Reflections on George Orwell’s „Inside the Whale“
www.ianmcewan.com/resources/docs/McEwan - Orwell_Lecture pdf, 15.10.2025