
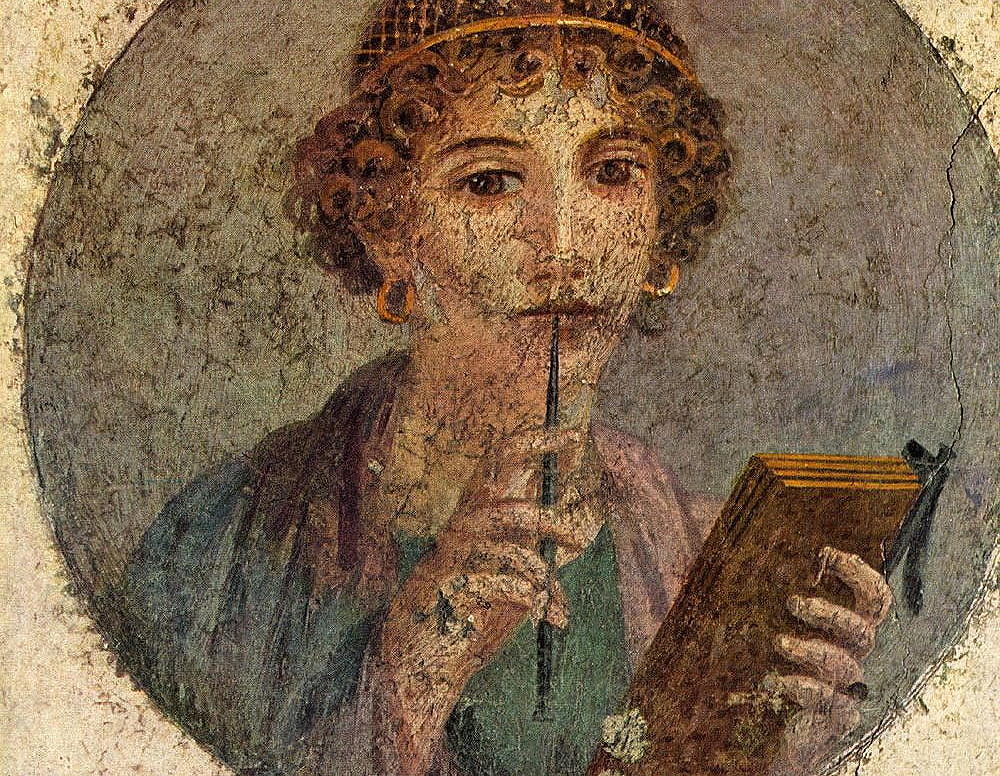

Camille Pissarro oder Von der Kühnheit zu malen
| Autor*in: | Anka Muhlstein |
|---|---|
| Verlag: | Insel Verlag, Berlin 2024, 302 Seiten |
| Rezensent*in: | John Burns |
| Datum: | 10.07.2025 |

Wer die Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam Mit offenem Blick. Der Impressionist Pissarro besucht, möchte unter Umständen sein Wissen um das Leben und Werk des Künstlers vertiefen. Hierzu empfehle ich das Buch von Anka Muhlstein Camille Pissarro oder Von der Kühnheit zu malen, Insel Verlag, Berlin 2024. Das Buch wurde von Ulrich Kunzmann aus dem Französischen übersetzt; der Originaltitel lautet Camille Pissarro. L‘Audace de peindre.
Die Autorin Anka Muhlstein wurde in Paris geboren und lebt seit 1974 in New York. Sie hat ihr Thema gründlich recherchiert, die zahlreichen Briefe Pissarros gesichtet, die Geschichte Frankreichs als Hintergrund ihrer Biographie geistreich eingearbeitet und den Maler-Kreis um Pissarro anschaulich geschildert.
Im ersten Raum der Barberini-Ausstellung hängen kleine Bilder aus den frühesten Arbeitsjahren des Künstlers, als er mit dem dänischen Maler Anton Melbye befreundet war. Mit Melbye unternahm Camille Pissarro eine Reise nach Venezuela, wo er exotische Landschaften malte und vor allem die Arbeit der Einheimischen in seinen Bildern festhielt. Pissarro entdeckte früh seine Begeisterung für das Visuelle. Er wollte malen und zeichnen, obwohl sein vorgezeichneter Lebensweg ihn zum Angestellten seiner Eltern hätte werden lassen, die auf der Insel St. Thomas ein florierendes Geschäft führten.
Auf der Insel St. Thomas, die häufig den Besitz wechselte, weil der Hafen Charlotte Amalie als Umschlagplatz des Handels zwischen Afrika, Europa, Nord- und Südamerika diente, wurde Camille Pissarro 1830 als Holländer geboren. Seine Eltern waren nicht-praktizierende Juden, die Geschäfts- und Verwandtschaftsbeziehungen zu England und Frankreich unterhielten. Sein Vater Frédéric Pissarro war in Frankreich geboren, seine Mutter Rachel Manzano Pomié kam 1795 auf der Insel St. Thomas zur Welt. Camille Pissarro starb 1903 in der französischen Hauptstadt Paris.
Der offene Blick, den die Barberini-Ausstellung dem Künstler attestiert und den die Biographin als Kühnheit bezeichnet, entstand sicherlich durch die unsichere Bindung des künftigen Malers an seine Familie, die sich in seinem ersten Versuch spiegelt, der Vereinnahmung durch die Geschäftswelt zu entkommen. Pissarro ging immer eigene Wege; er malte in einem neuartigen Stil Landschaften, Gärten, Straßen in Paris und in den kleinen Orten, in denen er später in Frankreich lebte. Er malte im Freien, zog seine Staffelei auf Rädern in die Felder hinein, wo er die Natur nicht so genau abbilden wollte wie die Realisten, sondern das Licht in dem von ihm ausgewählten Sujet in Farbe festhalten wollte.
Vereinnahmt wurde er trotz seines Aufenthalts in Paris, wo er im Kreis der damaligen Impressionisten an seinem Handwerk feilte, durch die Beziehung zu seiner stets kränkelnden Mutter, die nicht nur wehleidig, sondern auch fordernd war. Als ihr Sohn Camille mit der Küchengehilfin der Familie Julie Vellay in St. Thomas ein Kind zeugte und sie zu seiner Partnerin auserkor, weigerte sich seine Mutter, die künftige Lebensgefährtin ihres Sohnes anzuerkennen. Julie wurde von der Mutter Camilles schlicht abgelehnt. Ihr Name durfte in ihrem Beisein nicht fallen. Camille konnte seine Frau erst viele Jahre später ehelichen, als die Familie des Malers vor dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 nach London flüchtete.
Der Maler verfügte in seinen ersten Jahren über wenig Geld. Seine Bilder verkauften sich nicht; sie wurden von den jährlich in Paris stattfindenden Salons immer abgelehnt. Camille weigerte sich jedoch, seinen Malstil und seine Sujets zu ändern. Wenn er Kohlköpfe auf dem Feld malte, waren es eben keine schönen Blumen; Schneeszenen mit verdreckten Straßen waren seiner Meinung nach interessanter als eine von der Sonne durchflutete Landschaft im Sommer. Der offene Blick des Malers erfasste ohne Abscheu das neue Zusammenspiel der Kräfte, welche die Industrialisierung mit sich brachte. Im Hintergrund eines Waldstücks raucht ein Fabrikschornstein; am Ufer der Oise bei Pontoise zieht der Rauch eines von Dampf betriebenen Arbeitskahns über das ruhige, blau-leuchtende Wasser hinweg.
Camille Pissarro benötigte unter Umständen widrige Bedingungen, um schöpferisch tätig zu bleiben. Mit den vielen Bildern, die er malte, wollte er etwas Neues in die Welt setzen. Er war von früh an gewohnt, etwas zu ertragen, wie seine Biographin sein optimistisches Verhalten im Londoner-Exil kommentiert:
„Viele Jahre später erinnerte sich Pissarro an die Mittagessen, die er zusammen mit Monet bei Legros (das Haus des Malers und Grafikers Alphonse Legros – JB) einnahm. An jene Zeit, die für ihn sehr schwierig hätte sein können, erinnerte er sich gern zurück – ein weiterer Beweis, dass er stets ablehnte, sich von den Umständen überwältigen zu lassen. Pissarro hatte eine bewundernswerte Widerstandskraft. Jammern und Untätigkeit waren ihm fremd. Während der Monate im Exil überließ er sich niemals der Zukunftsangst“ (Muhlstein 2024, 82).
Ohne seine Frau Julie wäre Pissarro weniger optimistisch gewesen, als er nach Louveciennes in der Nähe der französischen Hauptstadt Paris zurückkehrte. Hier stellte der Maler fest, dass sein schönes Haus durch die Kriegshandlungen völlig zerstört worden war.
Julie war eine praktische Frau, die ihre kinderreiche Familie zu ernähren wusste. Sie war sehr gastfreundlich und wurde von den Maler-Freunden ihres Ehemannes sehr geschätzt, so dass die Familie gelegentlich von wohlhabenden Künstlern mit Lebensmitteln versorgt wurde. Julie legte Gemüsebeete an und züchtete Kaninchen; sie hielt Camille den Rücken frei, der immer nur malen wollte – aus der Sicht seiner Frau eine brotlose Kunst. An ihren Sohn Lucien schrieb sie:
„… Du musst unbedingt Deinen Lebensunterhalt verdienen. Wir leben immer in bedrängten Verhältnissen, die Geschäfte gehen sehr schlecht. Amüsiere dich vor allem nicht damit, Kunst zu machen. So etwas ist sinnlos. Tritt ins Geschäftsleben ein und lass diejenigen Kunst machen, die Brot auf dem Tisch haben“ (Muhlstein 2024, 149).
Die vielen Bilder, die Pissarro in Louveciennes zurücklassen musste, als er vor dem Krieg nach London flüchtete, wurden in seiner Abwesenheit von skrupellosen Opportunisten entwendet oder von Soldaten zerstört. Obwohl Pissarro im Kreis seiner Kollegen und Kollegin (Berte Morisot) oft als „Vater des Impressionismus“ bezeichnet wurde, meinte er, dass seine Faszination für Licht, Farbe und Gestaltung von früheren Malern her stamme. Im Londoner Exil nahm er sich z.B. die Zeit, die englische Malerei zu studieren. Er richtete sein Augenmerk vornehmlich auf den Romantiker William Turner: „Turner war vielleicht der Erste, der es verstand, die Farben in einem natürlichen Glanz aufleuchten zu lassen“ (Brief an Paul Gsell, zit. in Muhlstein, 83).
Die Kunst bildet die Natur nicht fotografisch ab, wusste Camille Pissarro, sondern entsteht in der Wechselbeziehung zwischen einer äußeren Wirklichkeit und dem Geist des Künstlers. Sie erzählt keine Geschichten von Göttern und Göttinnen, befasst sich nicht mit religiösen Märtyrern und schildert keine Schlachtszenen, denn „das gegenwärtige Leben, die moderne Stadt boten weitaus interessantere Sujets“ (Muhlstein 2024, 60). Der offene Blick des Impressionisten Camille Pissarro beeindruckte den Romanschriftsteller Emile Zola, der sich gern im Kreis der Künstler aufhielt:
„Zola gefiel vor allem die Ehrlichkeit eines Künstlers, der es ablehne, einfach etwas Hübsches zu machen. Er bewunderte, was er „seine heroische Schlichtheit“ nannte, seine Fähigkeit, die moderne Landschaft zu erfassen: Dort habe der Mensch seine Spuren hinterlassen, indem er den Boden umpflüge, ihn unterteile und die Horizonte verdüstere. „Nichts wäre banaler, wenn nichts größer wäre. Das Temperament des Malers hat aus der gewöhnlichen Wahrheit ein seltenes Gedicht des Lebens und der Kraft gewonnen““ (Muhlstein 2024, 67).