
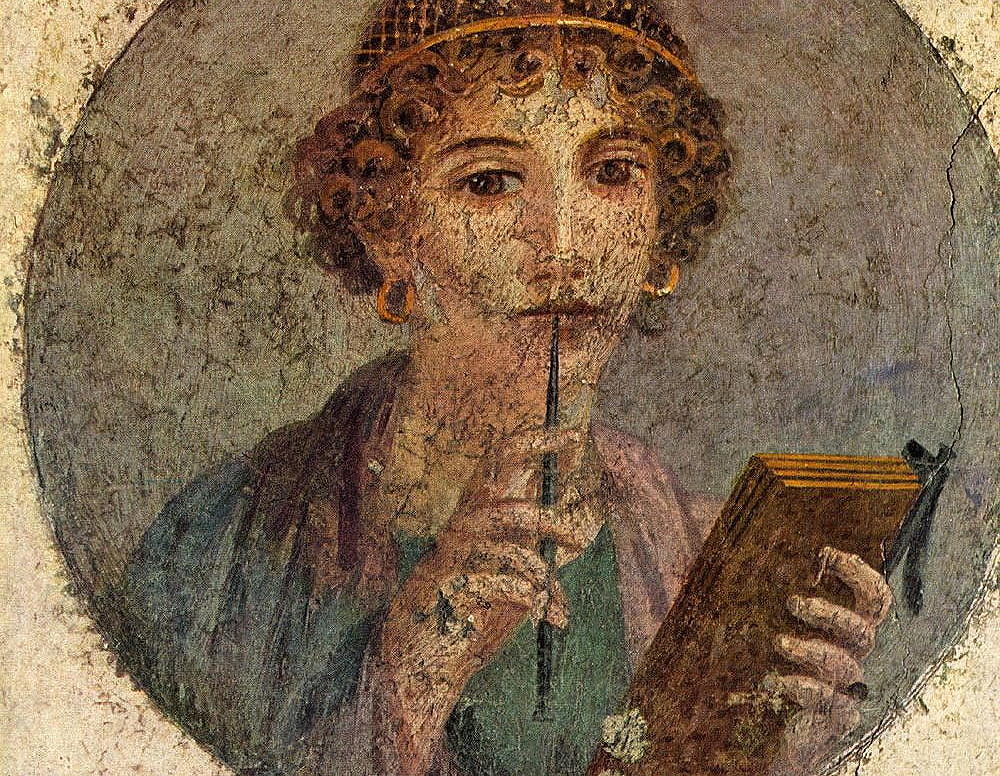

Orwells Rosen
| Autor*in: | Rebecca Solnit |
|---|---|
| Verlag: | Rowohlt Verlag, Hamburg 2022, 352 Seiten |
| Rezensent*in: | Annette Schönherr |
| Datum: | 04.08.2025 |
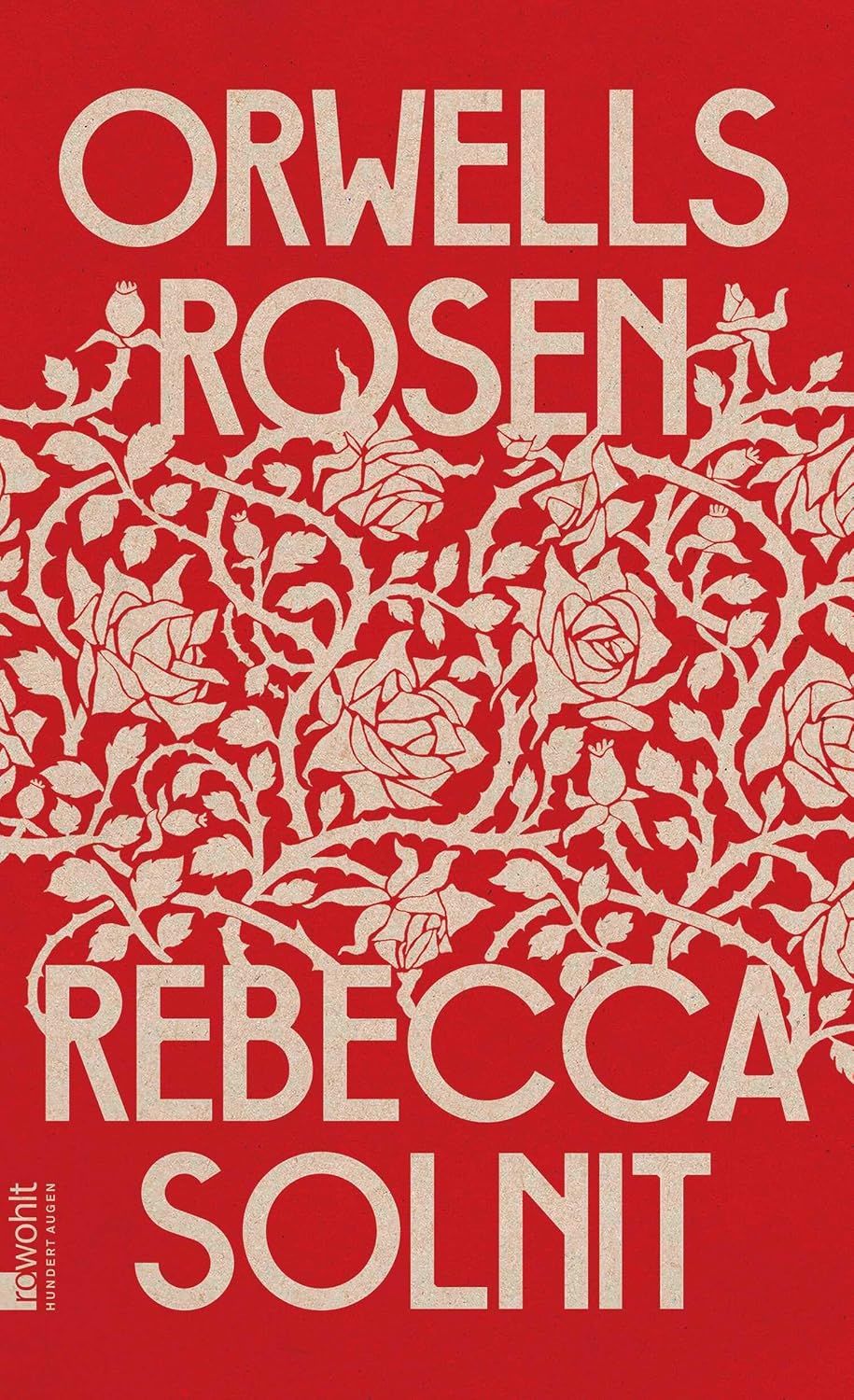
Rebecca Solnit (*1961) ist eine der bedeutendsten Essayistinnen der USA, die für ihre Werke zahlreiche Auszeichnungen erhielt, wie u.a. den renommierten National Book Critics Circle Award. Orwells Rosen ist ein beeindruckendes Essaywerk, das in einer krisenhaften Zeit entstanden ist und die Autorin als exzellente Kennerin des Lebens und Werks von Eric Blair alias George Orwell ausweist.
Mit Publikationen und Romanen wie 1984 und Farm der Tiere hat George Orwell seine Stimme eindringlich gegen Totalitarismus, Faschismus und Autoritarismus erhoben, und selbst in diesen Werken sind Wahrheit und Schönheit fühlbar. Solnit wollte verstehen, „wie Freude, Schönheit und Stunden ohne messbares praktisches Resultat zum Leben eines Menschen – vielleicht jedes Menschen – passten, dem gleichzeitig Gerechtigkeit, Wahrheit, die Menschenrechte und der Versuch, die Welt zu verändern, am Herzen lagen“. Dass dieser ernste, strenge und scheinbar nüchterne Schriftsteller Orwell auch ein leidenschaftlicher Freund der Rosen, Gärten, Natur, des Landlebens, der Tiere und gewöhnlichen Vergnügungen war, und dass er an Momente der Freude als politischen Widerstand glaubte, das schildert Rebecca Solnit in diesem Buch.
Mit der Geste des Rosenpflanzens eines Schriftstellers und einigen Abwandlungen davon führen die Streifzüge der Autorin den Leser immer wieder zu diesem zentralen Ausgangspunkt zurück: zu Orwells im Jahre 1936 gepflanzten Rosen, über die Solnit recherchierte und die zur Metapher und zum Akt des Widerstands werden. Orwells Reportagen der unmenschlichen Zustände der Bergarbeiter in Wigan Pier leiten über zu ihrer Reflexion des fossilen Kohlenstoffs als gespeichertes Pflanzenleben, während Brot und Rosen die Autorin zum Nachdenken darüber veranlassen, wie lebensnotwendig außer physischer Nahrung die ästhetischen Werte von Schönheit und Kunst sind. Orwells Kritik am Sowjetkommunismus führt sie zur Analyse der ideologischen Manipulation der Natur und zur Festigung des totalitären Regimes von Stalin. Des Weiteren wird die aristokratische Herkunft der Vorfahren Orwells im Zusammenhang mit kolonialer Ausbeutung kritisch hinterfragt, die verstehbar wird als Distanzierung Orwells von dieser Vergangenheit und deren Privilegien sowie seiner Namensänderung im Jahre 1933. Nicht zuletzt verliert der ästhetische Genuss duftender Rosen seinen Reiz angesichts der aktuell ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Rosenindustrie am Beispiel Kolumbiens. Schlussendlich erfolgt Solnits differenzierte Einordnung des Romans 1984, der ihres Erachtens zu einseitig als absolute Dystopie verkannt wird. Eine Betrachtung der letzten Lebensjahre Orwells auf der Schottland vorgelagerten Insel Jura bildet den Abschluss dieses Essays von Rebecca Solnit; diese Insel war ihm und seinem Adoptivsohn Richard trotz der kargen Lebensbedingungen eine Quelle von Freude und Ruhe und bot ihm einen Schutzraum gegen politische und persönliche Bedrängnisse.